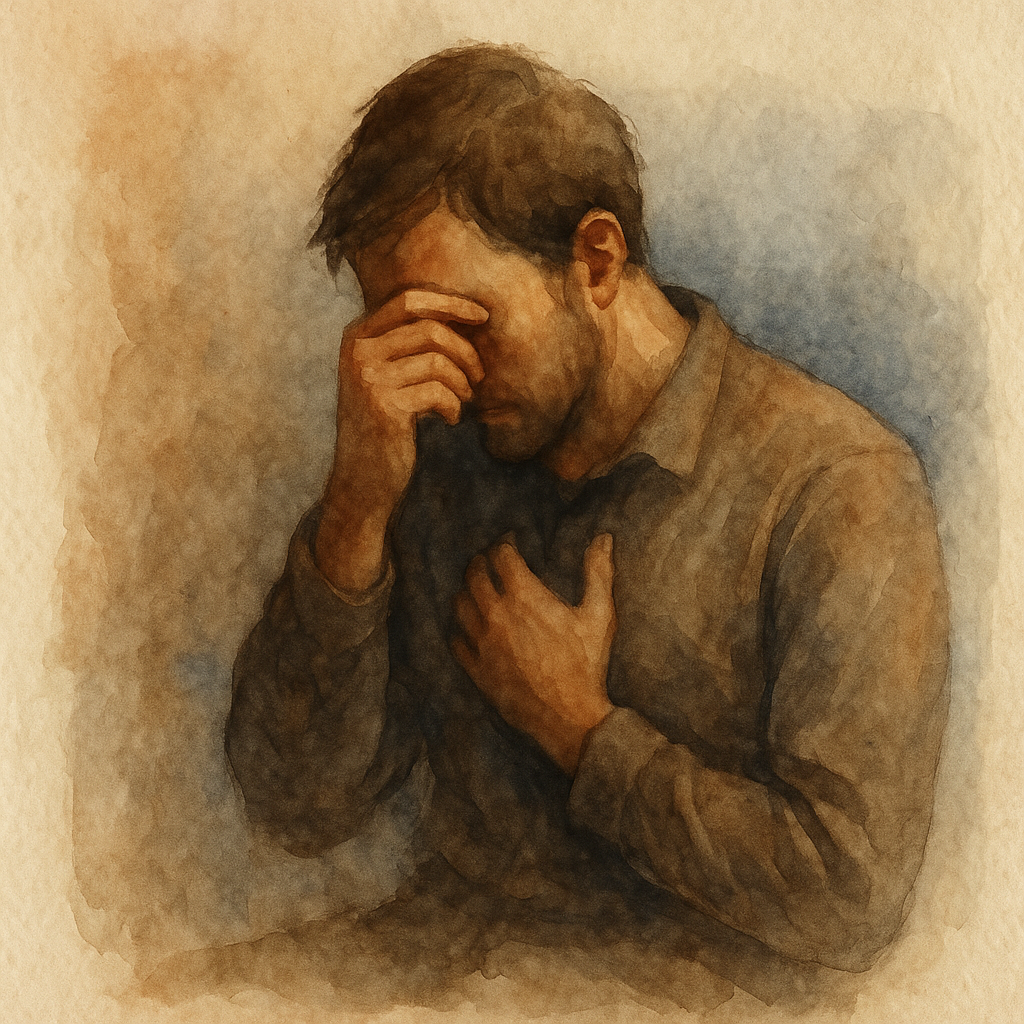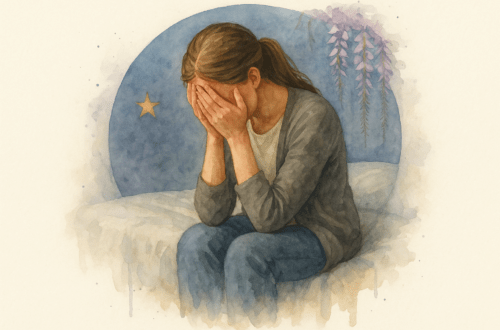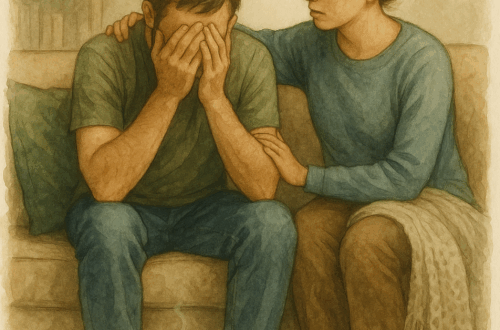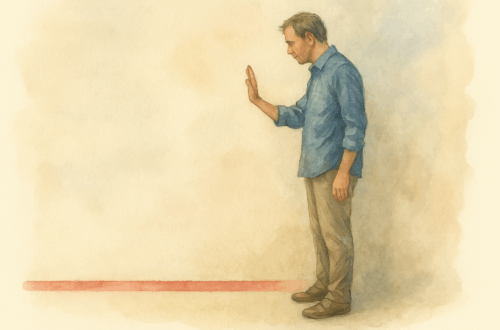Wenn ein lang ersehntes Baby vor oder bei der Geburt stirbt, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Doch während die Trauer der Mutter meist sichtbar und erwartbar ist, bleibt die Trauer bei Väter oft im Verborgenen. Ihre Umgebung fragt besorgt nach der Frau – aber was ist mit dem Vater? Dabei durchlebt auch ein Mann in diesem Moment einen tiefen seelischen Schmerz. Es war sein Kind, das er verloren hat, und mit diesem Verlust zerbrechen ebenso all seine Hoffnungen, Träume und Vorfreuden. In diesem Artikel wollen wir behutsam und zugleich fundiert beleuchten, was in trauernden Vätern vorgeht, warum ihre Trauer in der Gesellschaft oft tabuisiert und übersehen wird und wie betroffene Väter ihren eigenen Weg durch den Schmerz finden können. Es geht um psychische Reaktionen, Rollenbilder und Unterschiede im Trauern, um Auswirkungen auf Partnerschaft und Familie sowie um versteckte Symptome der Trauer. Vor allem aber möchten wir Väter sichtbar machen, Verständnis wecken und Mut zu Ausdruck, Selbstfürsorge und Mitgefühl zusprechen.
Psychische und emotionale Reaktionen von Vätern nach dem Verlust
Die Nachricht vom Verlust des eigenen Kindes – sei es durch eine Fehlgeburt im frühen Stadium oder eine stille Geburt später in der Schwangerschaft – trifft Väter meist völlig unvorbereitet. Im ersten Moment fühlen sich viele, als würde es ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Schock, Fassungslosigkeit und tiefe Traurigkeit treten ein. Ein Vater beschreibt den Moment der stillen Geburt seines Babys als den „brutalsten Moment“ seines Lebens. Häufig mischen sich auch Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht darunter: Männer empfinden quälend, dass sie „danebenstehen“ und ihrer Partnerin nicht helfen konnten. Viele Väter quält zudem der Gedanke, sie hätten etwas falsch gemacht oder nicht genug getan, um das Unglück zu verhindern.
Psychoanalytikerin Dr. Kathryn Eichhorn berichtet aus ihren Therapiegesprächen, dass Männer oft starke Schuldgefühle entwickeln – etwa die Sorge, die Partnerin in der Schwangerschaft nicht ausreichend unterstützt zu haben. Gleichzeitig zerplatzt der Lebenstraum „Jetzt werden wir eine Familie“ in tausend Scherben. Aus ihren Interviews und Studien weiß Eichhorn, dass Männer in Wahrheit genauso intensiv trauern wie die Mütter: *„Unsere Studie hat gezeigt, dass Männer sehr stark darunter leiden, nicht Vater eines lebenden Kindes geworden zu sein. Ihre Trauer ist ähnlich stark wie die der Mütter.“*.
Verzweiflung und Schmerz in der Trauer bei Väter
Verzweiflung und tiefer Schmerz begleiten viele betroffene Väter in den ersten Tagen und Wochen. Manche berichten, dass sie von heftigen Weinkrämpfen überwältigt wurden – selbst wenn sie sich vorher nie so erlebt hatten. „Ich habe mich gefühlt wie in einem Stummfilm… Dann bin ich auf die Toilette gegangen und da konnte ich nicht mehr, meine Gefühle haben mich komplett überwältigt. Die Tränen liefen und liefen und waren nicht zu stoppen. Das kannte ich von mir überhaupt nicht“, erinnert sich ein Vater an den Moment, als das Unfassbare Realität wurde.
Solche emotionalen Zusammenbrüche zeigen: Auch wenn Männer ihre Gefühle oft zurückhalten, ist der innere Schmerz enorm. Doch gerade weil ihre Trauer weniger sichtbar ist, wird sie von außenstehenden oft unterschätzt. So glauben viele noch immer, dass ein ungeborenes Kind zu verlieren für den Vater „nicht so schlimm“ sei wie für die Mutter – ein folgenschwerer Irrtum, denn „Schmerz kennt keine Schwangerschaftswoche“: Entscheidend ist, wie sehr man sich innerlich schon als Vater fühlte und das Baby liebte. Viele Männer haben vom positiven Schwangerschaftstest an eine Bindung aufgebaut und einen Platz in ihrem Herzen für das Kind geschaffen. Wenn dieses Zukunftsbild zerbricht, trauern auch Väter nicht um eine abstrakte „fehlgeschlagene Schwangerschaft“, sondern um ihren Sohn oder ihre Tochter, der sie all ihre Liebe schenken wollten.
Gesellschaftliche Erwartungen und das Tabu der Trauer bei Väter
Trotz der Häufigkeit solcher Verluste – allein in Deutschland gibt es jährlich geschätzt rund 110.000 sogenannte Sternenkinder – wird in der Öffentlichkeit kaum darüber gesprochen. Besonders männliche Trauer nach einer Fehl- oder Totgeburt ist ein Tabuthema. Noch immer herrscht das tradierte Rollenbild vom starken Mann, der Gefühle kontrolliert und keine Schwäche zeigt. Soziale Erwartungen setzen Väter unter Druck, gerade in Krisenzeiten „der Fels in der Brandung“ zu sein. Dr. Eichhorn bestätigt: *„Aufgrund der sozialen Rollenbilder sehen sich noch immer viele Männer in der Verantwortung, stark wirken zu müssen.“*
Viele Männer glauben tatsächlich, sie würden ihre Partnerin am besten stützen, indem sie selbst keine Trauer zeigen und „funktionieren“. Statt öffentlich Tränen zu vergießen, konzentrieren sie sich lieber auf praktische Aufgaben – organisieren Formalitäten, fahren die Partnerin zum Arzt, kümmern sich um den Alltag. Nach außen wirkt das Verhalten nüchtern und gefasst, was von der Umwelt leicht als Gleichgültigkeit missverstanden wird. In Wahrheit trauern die Männer aber „vor allem verdeckt“, wie Eichhorn sagt. Einer ihrer Patienten erzählte ihr nach dem Tod seines Babys zunächst sachlich: „Ja, so ist das halt. So ist das Leben.“ Erst später brach er in Tränen aus – ein Moment, der zeigte, wie unglaublich traurig er in Wirklichkeit war.
Ein Mann in Trauer mit Tränen im Gesicht
Die Trauer bei Väter bleibt oft unsichtbar, weil Männer glauben, stark sein zu müssen und ihre Gefühle verbergen. Doch ihr Schmerz ist real und tief – *„Ihre Trauer ist ähnlich stark wie die der Mütter“*. Oft fühlen sich Männer hilflos und ohnmächtig, weil sie ihrem ungeborenen Kind nicht helfen konnten.
Diese gesellschaftlichen Vorstellungen vom „harten Mann“ machen es vielen Vätern schwer, ihre Trauer zu zeigen. Hinzu kommt, dass der Verlust eines ungeborenen Kindes an sich oft vergeschwiegen wird. Ältere Generationen neigen dazu, solche Tragödien zu verdrängen – nicht selten kommt erst Jahrzehnte später ans Licht, dass es in der Familie einst ein verlorenes Baby gab. Früher dachte man, es sei „das Beste, schnell zu vergessen“. Männern fiel in diesem Schweigekartell die Rolle des Schweigers in besonderem Maße zu.
Bis heute heißt es bei einer Fehlgeburt schnell: „Sei froh, dass es so früh passiert ist“ oder *„Ihr könnt es ja nochmal probieren“*. Solche Sätze entspringen vielleicht einem verkorksten Trostversuch, verkennen aber die Tiefe des Verlusts und verletzen die Betroffenen zutiefst. Um nichts Falsches zu sagen, ziehen sich viele Freunde und Kollegen lieber ganz zurück und wechseln das Thema – was für trauernde Eltern wie Gleichgültigkeit wirkt. Männliche Trauer ist besonders unsichtbar: In der Außenperspektive scheint vor allem die Mutter zu leiden. Dass auch der Vater weint – ob nun innerlich oder heimlich für sich – passt nicht ins Klischee. Entsprechend wenig Raum wird ihm zugestanden.
Dieses Tabu wird zunehmend kritisiert. Experten bemängeln, die gängige Trauerpsychologie sei „keineswegs geschlechtsneutral, sondern sie ist weiblich“ – der Blick auf Trauerbewältigung orientiere sich an weiblichen Ausdrucksformen, was Männern nicht gerecht werde. Der Bedarf nach Angeboten für Männer wird lauter. Auch in den Medien melden sich mehr Betroffene zu Wort. Jüngere Väter brechen das Schweigen, sei es in Interviews, Büchern oder auf Social Media. Sie machen deutlich: Auch Väter haben das Recht zu trauern.
Ein eindrückliches Beispiel liefert der Hashtag #dadsgrievetoo („Auch Väter trauern“), den ein Sternenkind-Vater aus Deutschland mit Stolz auf seinem T-Shirt trägt. Damit will er die Botschaft nach außen tragen, dass seine Trauer kein Luxus oder Makel ist, sondern selbstverständlich und berechtigt. Langsam beginnt ein Wandel: Es ist, als würde unsere Gesellschaft allmählich anerkennen, dass die Trauer um ein „ungelebtes“ Leben ebenso echt und tief sein kann wie die um ein gelebtes. Doch bis männliche Trauer wirklich ohne Tabus sichtbar sein darf, ist es noch ein weiter Weg.
Familiäre Prägungen und traditionelle Männerbilder in der Trauer bei Väter
Warum fällt es Männern oft so schwer, offen zu trauern? Ein Grund liegt in der familiären Prägung und den klassischen Rollenbildern, mit denen viele von klein auf aufgewachsen sind. „Männer weinen nicht“, „Reiß dich zusammen“, „Du musst stark sein“ – solche Sätze haben Generationen von Jungen gehört. Viele heutige Väter haben als Kinder nie gesehen, dass ihr eigener Vater Gefühle zuließ. Geeignete Rollenvorbilder fehlen häufig. Wenn der eigene Vater nie über Kummer gesprochen hat, erscheint es einem Mann nahezu undenkbar, selbst plötzlich den Gang zum Therapeuten anzutreten oder im Freundeskreis über Ängste zu reden. Dr. Eichhorn erklärt, dass für viele Männer der Reflex, professionelle Hilfe zu suchen, aufgrund dieser Sozialisierung blockiert ist. So tragen sie lieber allein an ihrer Last, als Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Auch in Partnerschaften wirkt diese Prägung fort
Ein Vater erzählt, er habe zunächst nicht begreifen können, warum seine Frau ihn immer ermutigte: „Lass es raus, wenn es kommt, dann kommt es.“ Er war es nicht gewohnt, Gefühlen freien Lauf zu lassen – „meine Eltern haben mich anders erzogen“, sagt er. Erst als ihn der Verlust des Kindes mit voller Wucht traf und er hemmungslos weinte, verstand er, was seine Frau meinte. Vielen Männern sitzt der alte Kodex noch in den Knochen: Männer dürfen nicht weinen. Männer müssen stark sein.
Gefühle zeigen ist schwach. – „Das ist immer noch in uns drin“, so bringt es ein Vater auf den Punkt. Diese tief verinnerlichten Glaubenssätze führen dazu, dass viele ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht ernst nehmen. Statt sich selbst zu erlauben, untröstlich zu sein, definieren sie ihre Rolle ausschließlich über das Für-andere-stark-Sein. „Für mich bestand meine Aufgabe darin, für sie da zu sein und für sie stark zu sein, denn sie hatte noch mehr zu kämpfen als ich“, beschreibt ein Mann seine Haltung gegenüber der trauernden Partnerin.
Die traditionelle Vorstellung vom Mann als Beschützer und Versorger spielt hier ebenfalls hinein. Viele Väter sehen ihre Hauptaufgabe zunächst darin, die Partnerin zu stützen, die Familie „am Laufen“ zu halten und finanziell abzusichern – gerade jetzt, wo die Mutter durch die Geburt und den Verlust körperlich wie seelisch geschwächt ist. Eigene Trauer wird hintangestellt, fast als Luxusproblem. Dieser selbstauferlegte Anspruch kann dazu führen, dass Männer sich schämen, überhaupt Hilfe zu benötigen: Ihr persönlicher Schmerz scheint ihnen weniger legitim als der der Frau. Nach außen wollen sie funktionieren, innerlich fühlen sie sich aber oft zerrissen zwischen Rolle und Realität.
Erst allmählich brechen jüngere Männer aus diesen alten Bildern aus
Immer mehr Väter erkennen, dass Verletzlichkeit zeigen keine Schwäche ist, sondern Menschlichkeit. Sie wagen es, gegenüber Freunden oder der Familie anzusprechen, dass sie leiden. Doch für viele ist das ein Lernprozess. „Vielleicht müssen wir es erst lernen: Wenn ich traurig bin, ist Weinen der adäquate Emotionsausdruck – und nicht: Ich mache mir ein Bier auf“, formuliert Dr. Eichhorn treffend. Diese Um-Lernen braucht Zeit und oft die Erfahrung, dass Offenheit nicht verlacht, sondern mit Mitgefühl beantwortet wird. Hier können Vorbilder – andere Männer, die ihre Trauer leben – ungemein helfen, alte Prägungen aufzubrechen. Jede sichtbare Träne eines Mannes ist auch eine leise Rebellion gegen toxische Männlichkeitsideale.
Unterschiedliche Trauerstile von Männern und Frauen
Neben individuellen Prägungen spielen auch geschlechtstypische Unterschiede eine Rolle dabei, wie Trauer bei Väter und Müttern aussieht. Natürlich trauert jeder Mensch auf seine ganz persönliche Weise – es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ in der Trauer. Dennoch zeigen sich im Durchschnitt gewisse Tendenzen: Frauen verarbeiten Verluste häufig, indem sie verstärkt über Gefühle sprechen, Nähe suchen und ihre Trauer offen zeigen. Männer hingegen neigen eher dazu, ihre Emotionen zu kontrollieren, handlungsorientiert zu bewältigen und sich wieder in Aktivitäten zu stürzen. Viele Mütter empfinden ein großes Bedürfnis, intensiv über das Erlebte zu reden, Erinnerungen zu teilen und dem Sternenkind Raum zu geben – sie schreiben vielleicht darüber, gestalten ein Fotobuch oder suchen immer wieder das Gespräch über ihre Trauer. Demgegenüber versuchen manche Väter, nach außen ruhig und gefasst zu wirken. Sie wollen „die Fassade aufrechterhalten“ und so der Partnerin Sicherheit geben. Häufig kehren sie sehr schnell zurück in den Arbeitsalltag – in der Hoffnung, durch die gewohnte Struktur Halt zu finden und die Familie finanziell zu unterstützen. Arbeit und Alltag fungieren als Flucht nach vorn, um dem Chaos der Gefühle zu entkommen. Ein Vater erzählt: *„Von Männern wird erwartet, dass sie schneller wieder in den Alltag zurückfinden. Auch ich hatte das Gefühl, ’stark‘ sein zu müssen und wieder schnell… in die Arbeit zurückzukehren.“* Dieser Funktionsmodus ist für viele Männer die naheliegendste Bewältigungsstrategie – anpacken, weitermachen, nicht nachdenken.
Unterschiedliche Trauerstile können zu Missverständnissen in der Partnerschaft führen
Die Frau fühlt sich womöglich allein gelassen in ihrer Trauer, wenn der Mann scheinbar zur Tagesordnung übergeht. Sie könnte die Haltung des Partners als Gefühllosigkeit oder mangelnde Liebe zum Kind deuten. Der Mann hingegen denkt, er tue genau das Richtige, indem er stark bleibt und „das Leben am Laufen hält“. Beide wollen einander eigentlich schützen, doch sie reden aneinander vorbei. In der Paartherapie, so berichtet Dr. Eichhorn, sieht sie oft, wie das Risiko für Konflikte steigt, wenn Trauer verschieden ausgedrückt wird. Typische Konstellation: Er sagt „Ich will jetzt nach vorne schauen und das Ganze vergessen.“, worauf sie entgegnet: *„Ich möchte aber immer noch jeden Tag darüber sprechen.“* Wenn kein Verständnis füreinander aufgebracht wird, drohen Entfremdung und im schlimmsten Fall sogar Trennung. Denn die Kommunikation verschlechtert sich, wenn jeder den anderen nicht mehr erreicht.
Wichtig ist hier
Das man sich immer wieder bewusst macht, dass Männer und Frauen in der Trauer unterschiedliches Tempo und Timing haben. Nicht selten verarbeiten Mutter und Vater den Verlust zeitversetzt: Manche Trauerbegleiter beobachten, dass der Vater oftmals schon mitten im Trauerprozess steckt, während die Mutter zunächst die körperlichen Folgen von Geburt und Verlust bewältigen muss und erst etwas später emotional voll einsteigt. Dann fühlt sich vielleicht der Mann unverstanden, weil die Partnerin „erst jetzt“ so heftig trauert, oder umgekehrt die Frau, weil der Mann „schon wieder weit voraus“ zu sein scheint. Dieses Phasen-Versetztsein ist normal, aber es erfordert viel gegenseitiges Verständnis. Jeder trauert anders und oft auch zu unterschiedlichen Zeiten – kein Gefühl ist „falsch“ in so einer Situation.
Viele Paare schaffen es, diese Bewährungsprobe gemeinsam zu bestehen, wenn sie lernen, offen darüber zu sprechen und den jeweils anderen an ihrer Gefühlswelt teilhaben zu lassen. Kommunikation ist der Schlüssel. Es kann helfen, sich aktiv Zeiten zu nehmen, um über das Erlebte zu reden – aber auch zu akzeptieren, wenn der Partner gerade nicht sprechen mag. Manchmal tut es gut, gemeinsam zu schweigen und einfach den Verlust miteinander auszuhalten. Entscheidend ist, dass keiner den Eindruck hat, alleine zu stehen. Wenn beide Partner sich erlauben, unterschiedlich zu trauern, und dennoch füreinander da sind, kann die gemeinsame Trauerarbeit die Beziehung sogar stärken, betont Dr. Eichhorn. Viele Paare berichten im Nachhinein, dass sie durch die geteilte Tragödie enger zusammengerückt sind – weil sie zusammen durch die dunkelsten Stunden gegangen sind und gelernt haben, einander noch tiefer zu vertrauen.
Auswirkungen auf Partnerschaft und Familie
Der Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft ist nicht nur eine seelische Erschütterung für den Einzelnen, sondern stellt auch die Partnerschaft und das Familienleben vor enorme Herausforderungen. In den ersten Tagen nach der Fehl- oder Totgeburt erleben viele Paare eine Zeit enger Verbundenheit: Man rückt zusammen, teilt Tränen, hält sich gegenseitig fest. Doch je weiter die Trauer fortschreitet, desto häufiger treten auch Spannungen zutage – insbesondere, wenn die Partner unterschiedlich trauern (wie oben beschrieben). Missverständnisse und Schuldzuweisungen können die Beziehung belasten. Wenn ein Partner das Gefühl hat, der andere verstehe ihn nicht oder lasse ihn allein, entstehen leicht Groll und Rückzug. So kann zum Beispiel die Frau dem Mann insgeheim vorwerfen, er habe „kein Herz“, weil er scheinbar gefasst bleibt, während sie untröstlich ist. Oder der Mann fühlt sich von der Frau unverstanden, weil sie weiterhin regelmäßig weint und er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass diese unterschiedlichen Reaktionen keine Wertung der Liebe bedeuten – beide haben das gleiche Kind verloren und beide leiden, jeder auf seine Weise.
Eine offene Kommunikation und das gegenseitige Zulassen der Trauer können helfen
Es erfordert Mut, aber es kann die Beziehung retten, wenn beide Partner sich aufeinander zubewegen, anstatt sich im Schmerz voneinander abzuwenden. „Für eine gemeinsame Zukunft ist es wichtig, gemeinsam Trauerarbeit zu leisten“, betont Dr. Eichhorn – denn das kann die Bindung sogar vertiefen. Einige Paare entscheiden sich etwa, gemeinsam ein Ritual für ihr Sternenkind zu gestalten (dazu später mehr) oder in eine Paarberatung zu gehen, um Unterstützung bei der Trauerkommunikation zu erhalten. Andere finden auf eigene Faust einen Weg: Ein Vater berichtet, dass ihm und seiner Frau zunächst auch die Trauer „sortieren“ mussten, *„weil jeder Mensch unterschiedlich trauert“*. Doch die bereits starke Basis ihrer Ehe half ihnen dabei, zueinanderzufinden und die Erfahrung gemeinsam durchzustehen.
Nicht zu vergessen ist, dass eine Familie oft aus mehr Personen besteht als den Eltern des Sternenkindes. Gibt es bereits ältere Geschwisterkinder, sind auch sie von dem Verlust betroffen. Je nach Alter bekommen sie mehr oder weniger mit, was geschehen ist, spüren aber fast immer die Traurigkeit der Eltern. Kleinere Kinder können die Situation häufig nicht einordnen; sie registrieren nur, dass Mama und Papa anders sind – abwesender, trauriger, weniger belastbar. Jüngere Geschwister brauchen besonders sensible Begleitung: Manche Kinder entwickeln irrationale Schuldgefühle („Vielleicht ist das Baby gestorben, weil ich mir insgeheim kein Brüderchen gewünscht habe“). Eltern sollten ihnen liebevoll versichern, dass niemand an dem Tod schuld ist und dass böse Gedanken keine Folgen haben. Für Väter kann es eine Herausforderung sein, die Balance zu halten: Sie wollen einerseits für die trauernde Partnerin da sein, andererseits auch den Alltag für vorhandene Kinder stabil halten. Viele stürzen sich pflichtbewusst in die Versorgung der Geschwister, was ihnen auf der einen Seite Struktur gibt, aber auf der anderen Seite keinen Raum für die eigene Trauer lässt. Auch hier ist es wichtig, Hilfe von außen anzunehmen, wenn möglich – sei es von Großeltern, die sich um die Geschwister kümmern, oder durch Auszeiten für den Vater, in denen er sich sammeln kann.
Die weitere Familie und Verwandtschaft spielt ebenfalls eine Rolle
Manche Elternteile – sei es der Mann oder die Frau – fühlen sich von den eigenen Eltern oder Schwiegereltern unverstanden. Ältere Generationen neigen, wie erwähnt, eher zum Verdrängen. So kann es passieren, dass gut gemeinte Ratschläge wie „Schaut nach vorne“ oder „Ihr seid jung, ihr könnt noch Kinder haben“ kommen, wo eigentlich ein offenes Ohr nötig wäre. Für Väter, die ja häufig ohnehin wenig über Gefühle sprechen, kann eine solche Haltung im Umfeld dazu führen, dass sie sich noch mehr verschließen. Sie merken: Hier stoße ich mit meiner Trauer auf Unbehagen, also behalten sie alles für sich. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass der Mann sich vollkommen isoliert fühlt – unverstanden von Freunden, zurückgezogen von der Familie, innerlich einsam neben der eigenen Frau.
Umso wichtiger ist es, dass wenigstens ein nahestehender Mensch signalisiert: „Ich sehe auch DEIN Leid.“ Sei es ein Freund, der gezielt fragt: *„Wie geht es dir eigentlich damit?“*, oder die eigene Mutter, die den Sohn ermutigt zu reden. Leider erleben viele Väter genau das Gegenteil: „Mich haben alle nur gefragt, wie es meiner Frau geht… Aber es war auch mein Kind, und ich habe auch etwas verloren. Nur weil ich ein Mann bin, heißt das nicht, dass ich keine Gefühle habe“, berichtet ein betroffener Vater enttäuscht. Er fühlte sich *„tatsächlich sehr gekränkt und verletzt und sehr allein“*. Diese bittere Erfahrung teilen viele Männer: Ihr Umfeld bekundet der Frau Mitgefühl, während sie selbst kaum Beachtung finden. Das kann zu einer tiefen Verbitterung führen, die die Beziehung zur Familie und zu Freunden nachhaltig belastet, was gravierende Folgen haben kann.
Symptome verdeckter oder verdrängter Trauer bei Väter
Wenn Männer ihre Trauer nicht offen ausleben (können), sucht sich der seelische Schmerz oft verdeckte Ausdrucksformen. Psychologen sprechen hier von einer „versteckten“ oder auch maskierten Depression, die bei Männern anders aussehen kann als bei Frauen. Statt stiller Verzweiflung und Tränen treten dann Symptome wie Gereiztheit, Wut und erhöhte Risikobereitschaft auf. Dr. Eichhorn nennt es die „male depression“: *„Sie zeigt sich häufig nicht mit den klassischen depressiven Symptomen Traurigkeit oder Rückzug, sondern eher mit Reizbarkeit, Aggressivität, Risikoverhalten – beispielsweise Alkohol- oder Drogenkonsum oder übermäßigem Arbeiten.“*. Der trauernde Vater wirkt nach außen vielleicht unempathisch, rastlos oder aufbrausend, während er innerlich eigentlich leidet. Manche flüchten sich in exzessive Arbeit – Überstunden, zusätzliche Projekte oder Hobbys –, um den Schmerz nicht spüren zu müssen. Andere greifen vermehrt zu Alkohol oder Beruhigungsmitteln, um die quälenden Gedanken zum Schweigen zu bringen. Wieder andere entwickeln eine niedrige Reizschwelle und reagieren aggressiv auf Kleinigkeiten, was sie selbst kaum mit der Trauer in Verbindung bringen.
Körperliche Beschwerden können ebenfalls Anzeichen verdrängter Trauer sein
Psychosomatische Reaktionen reichen von chronischen Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Magen-Darm-Problemen bis hin zu unerklärlichen Schwindelgefühlen oder Herzrasen. Dr. Eichhorn berichtet von einem Vater, der nach dem Verlust seines Kindes unter heftigen neurologischen Zuckungen litt, für die es keine organische Ursache gab. Erst in der Therapie stellte sich heraus, dass diese Symptome eindeutig psychisch vermittelt waren – der Mann wollte das aber lange nicht wahrhaben. Dieses Abspalten des seelischen Schmerzes ist eine Art Selbstschutz: Was der Kopf nicht zulässt, schreit der Körper heraus. So können unerklärliche Beschwerden oft ein Hilfeschrei der Psyche sein.
Ein weiteres Indiz versteckter Trauer ist häufig eine Veränderung der Persönlichkeit oder Stimmungslage. Der Vater wirkt vielleicht wie ausgewechselt: früher fröhlich und geduldig, nun verbittert, zynisch oder ständig schlecht gelaunt. Einer gab zu Protokoll, dass sich seine Trauer „auf vieles ausgewirkt“ habe – plötzlich lief es im Arbeitsumfeld nicht mehr gut und die Stimmung war dauerhaft im Keller. Anfangs bemerkte er den Zusammenhang nicht, merkte nur, „warum bist du so, wie du gerade bist?“, bis ihm klarwurde, dass da noch etwas in ihm war, *„was noch nicht raus ist“*. Viele Männer realisieren erst spät, dass ihre scheinbar unmotivierte Wut oder innere Leere in Wahrheit unverarbeitete Trauer ist.
Leider suchen sich Väter oft erst sehr spät Hilfe
Nicht wenige schleppen über Monate oder Jahre einen Kloß im Herzen mit sich herum, ohne darüber zu sprechen. Während intensive Trauerreaktionen und selbst posttraumatische Symptome bei Müttern mit der Zeit tendenziell zurückgehen, bleiben sie bei Vätern in vielen Fällen länger bestehen, wenn sie nie Ausdruck fanden. Eine Übersichtsstudie ergab, dass die Trauer bei Väter häufiger unverändert hoch bleibt, während die Mütter allmählich Linderung erfahren. Die Männer kehren zwar oft schneller an den Arbeitsplatz zurück und suchen sich neue Herausforderungen als Coping-Strategie – doch innerlich tragen sie die unverarbeiteten Gefühle weiter mit sich. Stoizismus, Rückzug und harte Arbeit mögen kurzfristig helfen, können aber langfristig ungünstig für die Trauerbewältigung sein. Nicht selten mündet verdrängte Trauer dann in eine echte Depression, Angststörung oder auch in körperliche Erkrankungen.
Umso wichtiger ist die Botschaft: Achten Sie auf sich. Wer als Vater merkt, dass er seit dem Verlust „nicht mehr der Alte“ ist – sei es körperlich, emotional oder in seinem Verhalten –, sollte dies nicht ignorieren oder als persönliche Schwäche abtun. Es handelt sich um normale Reaktionen auf einen unnormalen Verlust. Es braucht niemand peinlich zu sein, wenn er nach einem solchen Schicksalsschlag leidet oder Hilfe braucht. Im Gegenteil: Es erfordert große innere Stärke, sich die eigene Verletzbarkeit einzugestehen und Unterstützung zu holen, bevor man völlig zusammenbricht.
Trauer bei Väter und das fehlende Verständnis im sozialen Umfeld
Ein großer Hinderungsgrund für Väter, ihre Trauer auszuleben, ist das oft fehlende Verständnis im sozialen Umfeld. Wie bereits angedeutet, neigen viele Mitmenschen dazu, den Schwerpunkt des Mitgefühls auf die Mutter zu legen. Freunde und Verwandte fragen: „Wie geht es deiner Frau?“, „Kommt sie zurecht?“ – doch der Vater wird selten direkt angesprochen. Dahinter steckt weniger Böswilligkeit als Unwissen oder Unsicherheit. Viele wissen schlicht nicht, wie sehr ein Mann betroffen sein kann. Andere haben Angst, ihn darauf anzusprechen, weil sie glauben, Männer wollten oder bräuchten nicht darüber zu reden. Diese Annahmen führen jedoch zu einer fatalen Folge: Der Vater fühlt sich unsichtbar in seiner Trauer.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein trauernder Vater Sätze zu hören bekommt wie „Du musst jetzt stark sein für deine Frau“ oder „Schau nach vorne, ihr schafft das schon“. Wohlmeinende Kollegen erwarten oft, dass er nach kurzer Zeit wieder „funktioniert“ und zur Normalität zurückkehrt. Vielleicht gibt es ein paar Tage Sonderurlaub oder Anteilnahme unmittelbar nach dem Verlust, aber schon bald flacht die Unterstützung ab. Während die Mutter eventuell länger im Krankenstand oder Mutterschutz ist und offenkundig Zeit zum Trauern hat, wird vom Vater vielfach erwartet, dass er rasch wieder arbeitet, „um sich abzulenken“. Dieser Druck von außen kann das Gefühl verstärken, dass für seine Trauer gar kein Raum vorgesehen ist. Wenn er dann doch einmal von sich aus etwas sagt oder Tränen zeigt, reagieren manche irritiert oder verlegen – sie hätten nicht gedacht, dass „es ihm so nahe geht“. Ein Vater berichtet: *„Auch heute noch mache ich die Erfahrung, wenn es um das Thema Fehlgeburt geht und ich frage, wie es dem Mann damit geht, werde ich immer noch komisch angeguckt, weil aus deren Perspektive meist nur die Frau etwas verloren hat.“*. Diese Erfahrung teilen viele: Noch immer herrscht unterschwellig das Bild, bei einer Fehlgeburt trauere im Grunde nur die Mutter wirklich – der Vater habe „weniger verloren“. Dieses Unverständnis kann wütend und bitter machen. „Das hat mich wirklich wütend und traurig gemacht… Es war auch mein Kind und ich habe auch etwas verloren. Nur weil ich ein Mann bin, heißt das nicht, dass ich keine Gefühle habe“, sagt der bereits zitierte Vater über die Reaktionen in seinem Umfeld.
Die Folgen dieser fehlenden Anerkennung ist oft, dass Männer sich zurückziehen
Wenn ohnehin niemand fragt, wie es ihnen geht, warum sollten sie es von sich aus erzählen? So warten sie insgeheim darauf, dass jemand ihnen den Raum gibt, darüber zu sprechen – doch dieser Moment kommt selten. Einer erwartete etwa von seinen besten Freunden oder Eltern, dass sie von sich aus fragen: „Wie geht es dir eigentlich damit? Möchtest du mal darüber reden?“, aber als das nicht geschah, trug er seine Trauer sehr lange mit sich herum. Viele Väter möchten ihre Partnerin auch nicht zusätzlich belasten und haben außerhalb der Beziehung niemanden, der zuhört. So entsteht ein Teufelskreis des Schweigens: Das Umfeld schweigt, weil es die Männer nicht verunsichern will – und die Männer schweigen, weil das Umfeld kein Interesse zu haben scheint.
Dabei sehnen sich viele insgeheim danach, dass jemand wirklich zuhört. Ein bewegendes Beispiel: Erst anderthalb Jahre nach seiner Fehlgeburt konnte der genannte Vater endlich loslassen – in dem Moment, als ein befreundeter Mann (der Ähnliches erlebt hatte) offen mit ihm darüber sprach. „Wir haben beide geheult. Und er war so dankbar, dass ich gefragt habe“, erzählt er. *„Ich habe das getan, was ich mir in meiner Situation gewünscht und erwartet hätte. Und das hat mich befreit, weil ich gemerkt habe, es ging nicht nur mir so, sondern es geht den meisten so.“*. Diese Erkenntnis, dass andere Väter genauso leiden und genauso wenig gefragt werden, hat ihn motiviert, in seinem Umfeld aktiv auf das Thema aufmerksam zu machen. Er spricht nun offen an, was er selbst erfahren hat: *„Die Partner werden so oft vergessen… Den meisten Männern geht es nicht gut. Die reden nicht drüber.“*.
Für das soziale Umfeld von trauernden Vätern lässt sich daraus eines lernen
Hinsehen und Nachfragen. Auch wenn ein Mann zunächst gefasst wirkt – man sollte niemals annehmen, dass er nicht trauert. Oft warten gerade die stillen, starken Männer am sehnlichsten darauf, dass jemand ihre unsichtbaren Tränen sieht. Ein einfaches „Wie geht es dir mit all dem?“ oder „Möchtest du erzählen, was du fühlst?“ kann Welten öffnen. Und wenn der Mann nicht reden mag, hilft vielleicht eine kleine Geste: ein ehrlicher Händedruck, eine Umarmung oder ein „Ich denke an dich“ als Nachricht. Hauptsache, er spürt: Seine Trauer wird gesehen und ernst genommen.
Bedeutung von Selbstfürsorge und Ausdrucksformen der Trauer bei Väter
Angesichts des Drucks, den sich viele Männer machen – für die Partnerin stark zu sein, die Familie zu versorgen, den Erwartungen der Umwelt zu genügen –, kommt die Selbstfürsorge bei trauernden Vätern oft zu kurz. Doch gerade sie ist essentiell, um langfristig nicht seelisch zu zerbrechen. Selbstfürsorge bedeutet, sich bewusst Zeit und Raum zu nehmen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu pflegen, was der eigenen Seele guttut. Das kann für Männer ungewohnt sein, doch es gibt viele Wege, die auch männlichen Trauerstilen entsprechen können.
Ein zentraler Aspekt ist, Gefühle einen Ausdruck zu verleihen – auf welche Art auch immer. Nicht jeder Mann möchte oder kann ausführlich reden. Doch es gibt Alternativen: Manche finden im Schreiben einen Zugang. Ein persönliches Tagebuch, in dem man unzensiert alle Gedanken rund um das Sternenkind festhält, kann befreiend sein. Andere Väter schreiben Briefe an ihr verstorbenes Kind – sie erzählen, was sie gemeinsam erlebt hätten, was sie bedauern, was sie ihrem Sternchen noch sagen wollten. Solche Briefe müssen nicht abgeschickt werden; alleine das Formulieren hilft, die Liebe und den Schmerz in Worte zu kleiden. Wiederum andere drücken sich vielleicht künstlerisch aus: durch Musik, indem sie ein Lied komponieren oder einem bestimmten Song besondere Bedeutung geben; durch Handwerk, etwa wenn sie etwas in Erinnerung an das Kind bauen oder basteln; oder auch durch Tätowierungen und andere Symbole, die ihre Verbindung sichtbar machen.
Sehr vielen Trauernden – Männern wie Frauen – helfen Rituale
Rituale spenden Halt, Struktur und ermöglichen ein bewusstes Abschiednehmen. Für Väter, die mit Worten ringen, kann ein Handlungsritual genau das Richtige sein: Zum Beispiel ein kleiner Abschiedsbrief, den man dem Baby ins Grab legt, oder das gemeinsame Pflanzen eines Baumes für das Sternenkind, den man wachsen sieht. In den Tagen und Wochen nach einer stillen Geburt bieten Krankenhäuser und Seelsorger oft an, Abschiedsrituale zu gestalten. Väter sollten sich nicht scheuen, diese Angebote anzunehmen, auch wenn es zunächst schwerfällt. Ein Vater berichtet, wie sehr es ihm half, sein still geborenes Töchterchen Ida im Arm halten zu dürfen und sich bewusst zu verabschieden. Früher wurde Eltern das Baby oft gar nicht gezeigt, heute weiß man, dass das bewusste Abschiednehmen heilsam wirkt. Viele Väter bewahren die kleinen Erinnerungsstücke, die man ihnen anbietet – den Hand- oder Fußabdruck des Babys, das Namensbändchen aus der Klinik, vielleicht ein Foto. Diese Dinge halten die Existenz des Kindes fest und geben dem Vater etwas in die Hand, wenn die Erinnerung zu verblassen droht. Auch das Geben eines Namens für das Sternenkind ist ein wichtiger Schritt. So haben viele Männer das Gefühl, ihr Kind offiziell anerkennen zu dürfen – es war nicht „nur ein Fötus“, es war ihr Sohn oder ihre Tochter mit Namen.
Im weiteren Trauerverlauf können eigene Rituale helfen, den Schmerz zu integrieren. Einige Väter richten sich daheim eine kleine Gedenkecke ein – mit Ultraschallbild, einer Kerze, einem Stofftier oder anderen Andenken. Dieser Platz erlaubt es ihnen, zwischendurch innezuhalten, eine Kerze anzuzünden und an ihr Sternenkind zu denken. Andere besuchen regelmäßig das Grab oder die Gedenkstätte ihres Sternenkindes, schmücken es zu besonderen Anlässen oder schreiben dort kleine Nachrichten auf Karten. Solche Handlungen geben der Trauer einen natürlichen Platz im Alltag. Auch Bewegung und körperliche Aktivität sind für viele Männer ein wichtiger Ausgleich: Sport kann wie ein Ventil wirken, angestaute Emotionen zu lösen. Ein Vater, leidenschaftlicher Läufer, schildert, dass er kurz nach dem Verlust trotzdem an Wettkämpfen teilnahm und seine Trauer als Motivation nutzte – „ich habe Ida als Geschenk angesehen, dass ich für sie Wege gehe“, sagt er. Die körperliche Anstrengung half ihm, sich selbst zu spüren, Kraft zu tanken und sich seiner Tochter nahe zu fühlen. Nach einem harten Training fühlte er sich manchmal so gelöst, dass er auf der Heimfahrt im Auto in Tränen ausbrach – *„ich spürte, dass ich etwas für Ida getan habe“*. Diese Verbindung von Bewegung und Emotion kann insbesondere Männern Zugänge eröffnen. Auch gemeinsame sportliche Aktivitäten mit anderen Betroffenen wirken oft Wunder: „Wenn man Sternenvätern einen Stuhlkreis anbietet, kommen sie nicht. Lädt man sie aber zum gemeinsamen Fußballspielen ein – ohne Zwang zu sprechen – sind sie da“, hat Dr. Eichhorn erfahren. In der Bewegung fällt das Reden oft leichter – oder es genügt schon die wortlose Kameradschaft, das Gefühl „wir sitzen alle im selben Boot“ und kicken zusammen.
Wichtig ist ausprobieren, was guttun könnte.
Selbstfürsorge heißt auch, auf den eigenen Körper zu hören: Schlaf nachholen, wenn man erschöpft ist; auf Ernährung achten, gerade wenn der Stress zu Magenproblemen führt; Pausen in der Arbeit einlegen, wenn die Konzentration fehlt. Es kann helfen, sich kleine Inseln im Alltag zu schaffen – etwa jeden Abend einen kurzen Spaziergang allein, um den Gedanken nachhängen zu dürfen. Oder sich an einem festen Wochentag mit einem Freund zu verabreden, der zuhört, falls man reden mag. Professionelle Hilfe gehört übrigens auch zur Selbstfürsorge: Eine Therapie oder Trauerbegleitung ist kein Zeichen des Versagens, sondern im Gegenteil ein Akt der Vorsorge für die eigene psychische Gesundheit. „Es ist wichtig, den betroffenen Vätern einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie trauern und einmal nur über sich sprechen dürfen – ohne Schuldgefühle…“, erklärt Dr. Eichhorn. Dieser Raum – sei es in der Einzeltherapie oder in einer speziellen Vätergruppe – ermöglicht es, mal die ganze Last abzugeben, die man sonst alleine trägt. Oft fühlen sich Männer nach einigen Sitzungen deutlich entlastet, weil sie endlich all das aussprechen konnten, was sie gegenüber der Partnerin oder Familie zurückgehalten haben.
Möglichkeiten der Unterstützung: Gruppen, Therapie, Seelsorge, Onlineangebote
Viele Väter zögern, Hilfe von außen anzunehmen. Doch wer den Mut fasst, Unterstützung zu suchen, wird feststellen, dass es inzwischen eine Reihe von Angeboten gibt – und dass diese ungemein entlasten können.
Eine erste Anlaufstelle kann die Selbsthilfe sein. In ganz Deutschland existieren Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern nach Fehl- oder Totgeburt, und zunehmend auch spezielle Treffen nur für Sternenkind-Väter. Oft sind solche Gruppen regional organisiert (unter Namen wie „Sternenkinder [Stadt/Region]“). Dort treffen sich Eltern – und mancherorts gezielt Väter –, die Ähnliches erlebt haben, zum offenen Austausch. Vielen Müttern und Vätern hilft es enorm, andere Betroffene kennenzulernen. Das Gefühl, nicht allein zu sein mit diesem Schicksal, nimmt viel von der Isolation. Ein Vater, der in München regelmäßig einen Abend für Sternenkind-Väter anbietet, berichtet: *„Geteiltes Leid ist halbes Leid. Es kann erleichternd sein, in Kontakt mit anderen Männern zu sein, die wissen, wie es einem gerade geht“*. Dabei muss gar nicht permanent gesprochen werden: Schon das gemeinsame Schweigen unter „Leidensgenossen“ kann tragen. Wenn in Ihrer Nähe keine spezielle Vätergruppe existiert, kann auch der Besuch einer gemischten Trauergruppe für verwaiste Eltern sinnvoll sein. Adressen und Termine erfährt man über örtliche Beratungsstellen, Kliniken oder Vereine wie die Initiative Regenbogen oder Verwaiste Eltern e.V..
Neben Selbsthilfegruppen gibt es auch professionell geleitete Trauergruppen oder Gesprächskreise, teilweise angeboten von Kirchen (Seelsorge) oder psychologischen Beratungsstellen. Hier moderieren erfahrene Trauerbegleiter oder Therapeuten die Treffen. Einige Organisationen haben erkannt, dass Männer andere Settings bevorzugen – etwa Treffen in ungezwungener Atmosphäre oder verbunden mit einer Aktivität. So gibt es z.B. Wandergruppen oder Outdoor-Wochenenden für trauernde Väter, wo man beim Gehen in der Natur ins Gespräch kommt.
Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Unterstützung ist die Einzel- oder Paartherapie
Scheuen Sie sich nicht, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut kann einen geschützten Raum bieten, in dem alle Gefühle erlaubt sind – auch Wut, Verzweiflung oder Schuld. Gerade Männer profitieren oft von diesem Setting, weil sie hier einmal nicht für jemand anders stark sein müssen, sondern ganz im Mittelpunkt stehen dürfen. Wenn die Partnerschaft schwer belastet ist, kann eine Paartherapie helfen, die unterschiedlichen Trauerweisen zu vermitteln und Missverständnisse abzubauen. Viele Paare empfinden es als Erleichterung, mit einer neutralen dritten Person über das Erlebte zu sprechen und neue Wege des Miteinanders zu finden. Sollte die Hemmschwelle zu einem Therapeuten zu gehen hoch sein, bedenken Sie: Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut und Fürsorge – für sich selbst und die eigene Familie. Und vielleicht müssen wir wirklich noch lernen, wie Eichhorn sagt, dass Weinen und Reden normal sind, wenn man traurig ist. Therapie kann ein Ort sein, dieses Zulassen einzuüben.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der Seelsorge. In vielen Krankenhäusern stehen direkt nach einer stillen Geburt Klinikseelsorger bereit, die Gespräche anbieten. Auch Wochen oder Monate später kann man sich an kirchliche oder andere seelsorgerische Einrichtungen wenden – unabhängig von der eigenen Religiosität. Seelsorger sind geschult im Umgang mit Trauer und oft sehr einfühlsam, gerade auch mit Männern, die nicht recht wissen, wie sie anfangen sollen. Manchmal tut es gut, in einem geschützten Rahmen (der Beichtstuhl von früher ist heute oft ein offenes Gesprächszimmer) alles rauszulassen, was einen quält, und vielleicht gemeinsam ein kleines Ritual oder Gebet für das Sternenkind zu gestalten. Seelsorge ist meist kostenlos und niedrigschwellig zugänglich.
In der heutigen Zeit spielen natürlich auch Online-Angebote eine große Rolle
Vielen Vätern mag es anfangs leichter fallen, anonym im Internet nach Gleichgesinnten zu suchen. Es gibt inzwischen etliche Foren, Facebook-Gruppen und Instagram-Communities, in denen Sternenpapas miteinander ins Gespräch kommen. Dort kann man Erfahrungen austauschen, Fragen stellen oder einfach nur mitlesen und feststellen, dass andere genau die gleichen Gefühle und Probleme haben. Einige Blogs und YouTube-Kanäle werden von betroffenen Vätern betrieben, die offen über ihre Trauer sprechen – zum Beispiel persönliche Erfahrungsberichte oder Interviews mit Experten. Diese können eine erste Stütze sein, wenn man sich selbst noch nicht bereit fühlt, von Angesicht zu Angesicht darüber zu reden. Allerdings ist bei Online-Ressourcen auch Vorsicht geboten: Nicht jeder Rat aus dem Internet passt zu jedem, und manche Berichte können einen auch triggern. Nutzen Sie das, was Ihnen gut tut, aber zögern Sie nicht, professionelle Hilfe aufzusuchen, wenn Sie merken, dass Sie alleine nicht weiterkommen.
Zusammenfassend gilt: Es gibt Hilfe, und es ist okay, sie anzunehmen. Ob im Gespräch mit einem Freund, in der Männerrunde beim Fußball, in der Selbsthilfegruppe, bei der Trauerbegleiterin oder im Internet-Forum – irgendwo gibt es jemanden, der zuhört und versteht. Viele Einrichtungen und Vereine arbeiten daran, die Unterstützung für trauernde Väter auszubauen, denn lange Zeit waren sie eine übersehene Gruppe. Schritt für Schritt entstehen mehr Anlaufstellen von Männern für Männer, wie es Trauerbegleiter Roland Kachler fordert. Nutzen Sie diese Angebote, wann immer Sie dazu bereit sind. Kein Vater sollte den Weg durch die Trauer allein gehen müssen.
Ermutigung zu Sichtbarkeit und Mitgefühl
Abschließend möchten wir Mut machen – sowohl den betroffenen Vätern selbst als auch ihrem Umfeld. An die Väter gerichtet: Trauern Sie auf Ihre Weise, aber verstecken Sie sich nicht aus Scham. Ihre Trauer ist kein Versagen an Männlichkeit, sie ist ein Zeichen Ihrer Liebe zu Ihrem Sternenkind. Sie haben jedes Recht, genauso tief zu fühlen und zu trauern wie Ihre Partnerin. Wenn Ihnen nach Weinen ist, dann weinen Sie – es ist keine Schwäche, sondern oft der einzig angemessene Ausdruck dessen, was Sie empfinden. Suchen Sie sich Menschen, bei denen Sie echt sein dürfen. Das können enge Freunde sein, andere Sternenkind-Väter oder professionelle Helfer. Warten Sie nicht darauf, dass jemand von allein fragt – haben Sie den Mut, selbst das Schweigen zu durchbrechen. Ein Vater rät aus Erfahrung: *„Wenn niemand fragt, dann sprich die Menschen aktiv an. Fordere das Ohr anderer ein. Sprich darüber. Wenn dich keiner auffordert oder keine Fragen stellt, dann mach es selbst.“*. Diese Offenheit wird nicht immer auf Verständnis stoßen, aber sie ist der einzige Weg, damit Ihre Trauer sichtbar werden kann. Und Sie werden überrascht sein, wie viele Männer insgeheim Ähnliches erlebt haben und dankbar sind, wenn endlich jemand das Thema anspricht. Jeder Austausch kann ein Stückchen Last von Ihrer Seele nehmen – teilen Sie Ihr Leid, es wird leichter zu tragen.
An die Gesellschaft, an Freunde und Familie:
Schauen Sie hin. Lernen Sie, auch bei Männern zwischen den Zeilen zu lesen. Oft steckt hinter dem scheinbar ruhigen Äußeren ein Sturm der Gefühle. Fragen Sie den trauernden Vater, wie es ihm geht – und hören Sie wirklich zu, ohne vorschnelle Ratschläge. Vermitteln Sie ihm, dass er nicht stark sein muss für Sie. Lassen Sie ihn weinen, wütend sein oder schweigen, und zeigen Sie ihm, dass Sie da sind. Ein Satz wie „Ich habe keine Worte, aber ich fühle mit dir“ kann Wunder wirken. Ebenso wichtig: Mitgefühl statt Floskeln. Vermeiden Sie die oben erwähnten Sätze, die den Verlust kleinreden (à la „Ihr könnt ja noch ein Kind bekommen“). Bedenken Sie, dass für die Eltern – und eben auch für den Vater – die Welt zusammengebrochen ist. Erkennen Sie das Kind als Teil der Familie an, wenn die Eltern das möchten. Erinnern Sie an den Namen des Sternenkindes, zünden Sie vielleicht am Geburtstag eine Kerze an oder schicken Sie an schweren Tagen eine mitfühlende Nachricht. Solche Gesten signalisieren dem Vater: Dein Kind ist nicht vergessen, deine Trauer ist nicht peinlich, wir trauern mit dir. So wird die Isolation durchbrochen.
Es tut sich bereits einiges: Immer öfter berichten sogar Prominente offen von ihren Sternenkindern, Gedenktage wie der Weltgedenktag für verstorbene Kinder am 15. Oktober bekommen öffentliche Aufmerksamkeit. Mit jedem Gespräch, jedem einfühlsamen Artikel, jedem Kerzenlicht im Fenster am Gedenktag wird das Schweigen ein Stück mehr gebrochen. Diese Entwicklung sollten wir weiter vorantreiben. Jeder Vater, der sich traut, seine Trauer zu zeigen, macht den nächsten Männern Mut, es auch zu tun. Und jedes Umfeld, das einem Vater aktiv Beileid und Verständnis entgegenbringt, setzt ein Zeichen gegen das Tabu.
Am Ende lässt sich die Trauer nicht wegmachen. Ein Sternenkind wird immer Teil der Familie bleiben, und die Trauer wird Teil des Lebens der Eltern bleiben – bei Männern ebenso wie bei Frauen. Aber sie muss nicht das ganze Leben beherrschen. Viele Eltern – auch Väter – berichten, dass der Schmerz mit der Zeit anders wird: Er bleibt ein Stein im Herzen, aber man wächst an ihm und kann ihn eines Tages besser tragen. Dafür braucht es Zeit und aktive Trauerarbeit. Kein Vater „steht da einfach drüber“, aber man kann lernen, ohne Schuld und Scham nach vorne zu blicken, ohne dabei sein Sternenkind zu vergessen. Dabei darf sich jeder Hilfe holen, der sie braucht – niemand muss diese Last allein stemmen.
Ein paar Worte an dich
Lieber trauernder Vater, wenn du diese Zeilen liest, dann hoffe ich, dass du dich ein wenig weniger allein fühlst. Deine Trauer ist real, sie ist erlaubt, und sie verdient Gehör. Sprich sie aus, in welcher Form auch immer, und lass dir von niemand einreden, du müssest sie verstecken. Lieber Mitmensch eines Sternenkind-Vaters, wenn du bis hier gelesen hast, dann hast du bereits einen wichtigen Schritt getan: Du hast hingeschaut. Schenke diesem Vater weiterhin deine Aufmerksamkeit und dein Herz. Hilf mit, dass Väter nicht länger im Schatten trauern müssen, sondern dass ihre stille Trauer eine Stimme bekommt – inmitten unserer Gesellschaft, inmitten unserer mitfühlenden Herzen. Die Trauer bei Väter sollte nicht vergessen werden.
FAQ – Trauer bei Vätern
Knappe Antworten aus dem Artikel: männliche Trauer sichtbar machen – ohne Druck, in Dosen, mit Haltung und guter Fürsorge.
Oft ja – nicht weniger, sondern anders: mehr Handeln, Struktur, Zurückhaltung. Das nennt man ein instrumentelles Trauermuster. Gefühle sind da, werden aber häufiger im Tun reguliert.
Rollenbilder („stark sein“) und Sprachlosigkeit machen Trauer unsichtbar. Viele regeln Organisatorisches und halten innerlich aus – das ist Trauer, nur leiser gezeigt.
Stabilität & Bedeutung: Rhythmus, Schlaf/essen/bewegen, sichere Menschen, kurze Sätze mit Wahrheit („Ich bin traurig, heute mache ich …“), kleine Rituale mit Name/Ort/Licht.
In Dosen: ein Satz morgens/abends, drei lange Ausatmungen, kurzer Blick zum Erinnerungsort – dann bewusst schließen (Fenster, Tee, Schritt nach draußen). Lieber oft & klein als selten & tief.
Zwei Fragen sortieren: Wofür war ich verantwortlich? Worauf hatte ich damals Einfluss? Formulierung: „Ich wünschte … – und mit dem damaligen Wissen handelte ich so.“ Schuld entgiftet, Verantwortung bleibt klar.
Wut ist Bindungsenergie. Sicher abladen: länger ausatmen als einatmen, Gehen/Schwitzen, Boxsack/Handwerk, Worte finden („Ich bin wütend, weil es wichtig war“). Danach kurz beruhigen (Wärme, Wasser).
Beides. Trauer pendelt. Absprachen helfen: Wie viel Nähe heute? Wie schließen wir danach? Kleine, wiederholbare Begegnungen – und Rückwege, wenn es zu viel wird.
Täglich 10-Minuten-Check-in: Was war schwer, was gut, was braucht jede*r morgen? Ampelsprache (grün/gelb/rot), klare Aufgaben, keine Vergleiche. Sichtbar trauern, nicht bewerten.
Abschied und Wochenbett gleichzeitig. Fürsorge heißt: Organisation tragen, Schutz geben – und Gefühle in kurzen Sätzen zeigen. Ein kleiner eigener Ort hilft, nicht nur „zu funktionieren“.
Ein kurzer, klarer Satz, eine Ansprechperson, ein Pausen-Signal. Plane Rückkehr in Stufen. Du schuldest niemandem Details – aber dir selbst einen Rahmen, der dich schützt.
Wenn–Dann-Plan, Begleitung einplanen, Mikropendel (kurz annähern – klar schließen – nährende Insel). Dosis am Körper prüfen: Atem, Muskeltonus, Blickweite.
Schlicht & würdig: Name sagen, Kerze, kleiner Ort, Mini-Briefe, etwas Handwerkliches (Box, Rahmen, Baum), Bewegung + Gedenken (Spaziergang mit einem Satz).
Altersgerecht, ehrlich, kurz. Name und Zugehörigkeit benennen. Ein kleiner Auftrag (Stein legen, Bild malen) gibt Halt. Fragen beantworten, ohne zu überfluten.
Ja. Nähe bleibt in neuer Form: Name, Ort, Jahresritual, innerer Satz. Beziehung würdig halten – ohne den Alltag zu überfluten. Kein Loslassen-Druck nötig.
Betäubung schützt. Hol den Körper dazu (Atem, Wärme, Wasser, Gehen), kleine Dosen Nähe, dann wieder Alltag. Gefühle kommen oft zeitversetzt – erlaubt.
Rahmen statt Heldentum: gleiche Abläufe, Begleitperson, Pausen-Signal, kurze Nachintegration. Fokus: „Was entspricht heute unserer Liebe?“
Wenn Schlaf/Appetit/Antrieb wochenlang fehlen, Panik/Betäubung dominieren, Hoffnungslosigkeit anhält – oder wenn du Begleitung willst. In Not: 112; TelefonSeelsorge: 116 123; Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117.
Väter-Selbsthilfegruppen, Trauerbegleitung vor Ort, Hospizdienste, Seelsorge, Online-Foren/Chats. Gemeinschaft entlastet – du musst das nicht allein tragen.