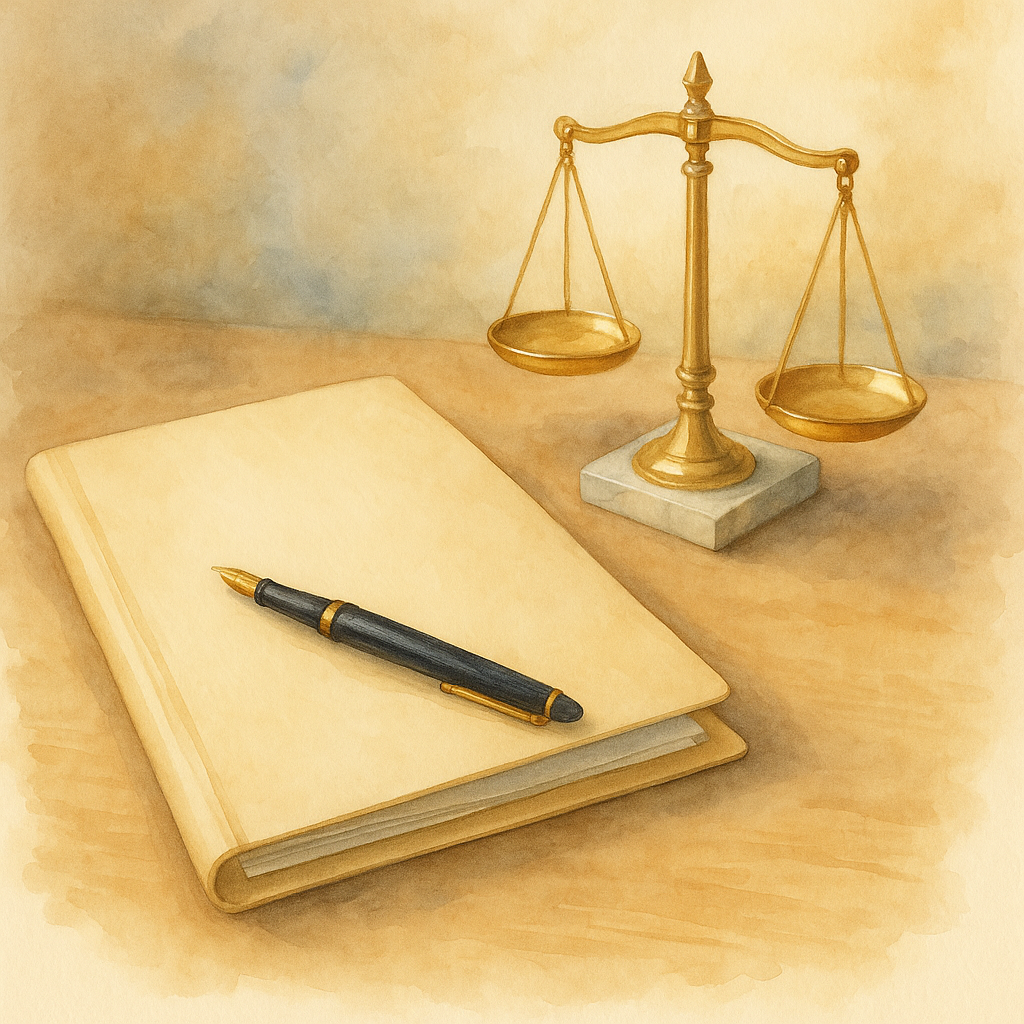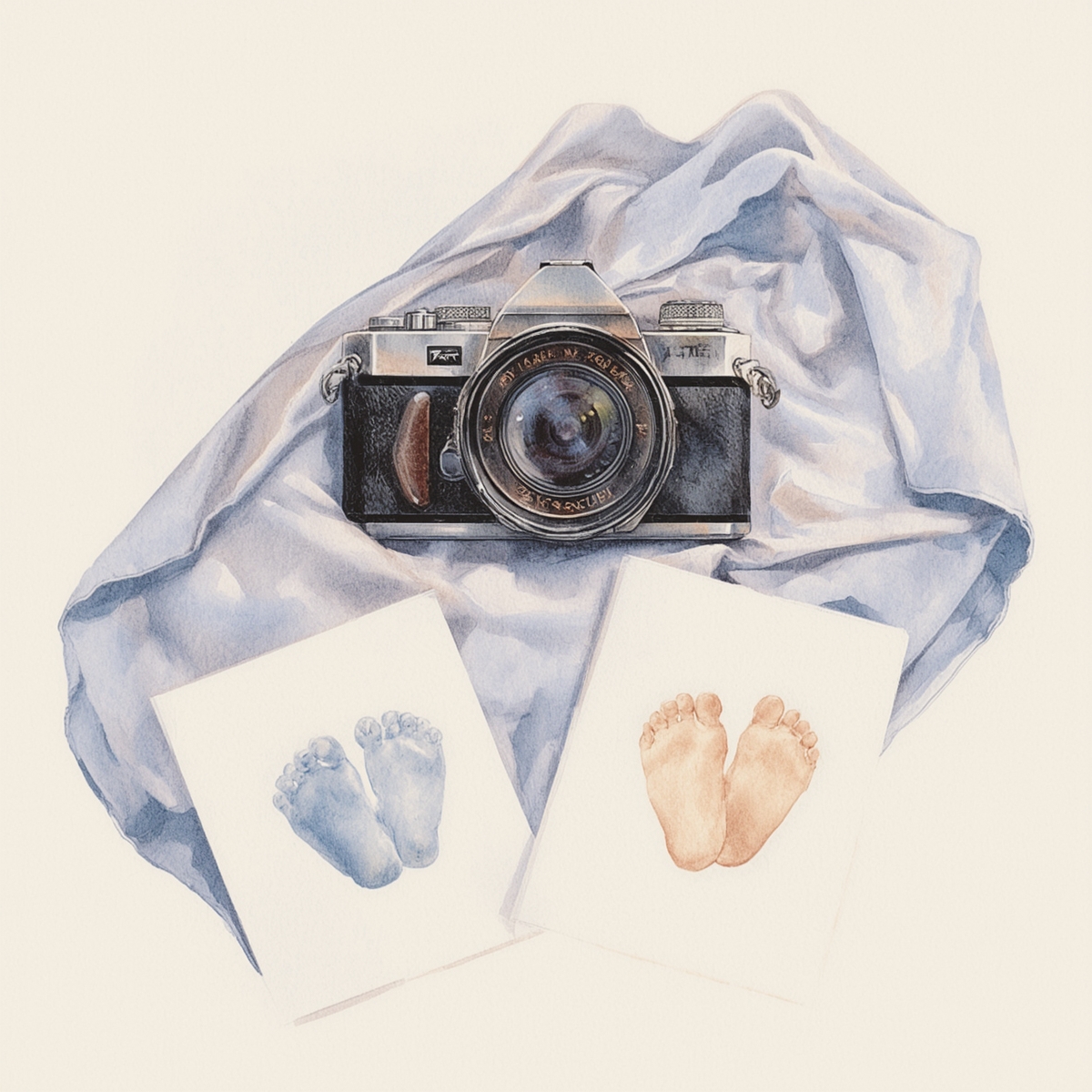Rechtliches rund um Sternenkinder
Dieser Beitrag sortiert die wichtigsten Regelungen bei Fehl- und Totgeburt – was ihr dürft, was ihr könnt, was (selten) wirklich Pflicht ist. Ich beziehe mich auf Bundesrecht und – wo nötig – auf Unterschiede der Landesgesetze. Lies in Ruhe, nimm dir nur das, was heute hilft.
Du findest hier die großen Themen in klarer Sprache: Personenstand (Fehlgeburt vs. Totgeburt), Namen und Standesamt, Bestattung (Pflicht oder Möglichkeit), Mutterschutz und Krankschreibung, Einsichts- und Aufklärungsrechte (inklusive Fetopathologie), Fristen und Formales, Datenschutz sowie Besonderheiten bei sehr frühen Verlusten und Mehrlingen. Wo es regionale Unterschiede gibt – vor allem bei Bestattungsformen, Fristen und Aufbahrung – sage ich das dazu und verweise ausdrücklich auf Standesamt oder Friedhofsamt vor Ort.
Wichtig ist mir die Unterscheidung zwischen Option und Pflicht. Vieles dürft ihr – wenig müsst ihr sofort. Ihr dürft euer Sternenkind benennen, ihr könnt Dokumente beim Standesamt bekommen, ihr könnt würdig bestatten; Pflichten greifen vor allem bei Totgeburten. Beim Thema Mutterschutz nenne ich auch die aktuelle Rechtslage und angekündigte Neuerungen, damit ihr einschätzen könnt, was jetzt schon gilt und was kommt.
Kein Ersatz für Rechtsberatung – wozu dieser Text dient
Der Text ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er will euch einen ruhigen Rahmen geben, damit Gespräche mit Klinik, Amt und Arbeitgeber verständlicher werden. Wenn etwas unklar bleibt, helfen zwei Sätze, die Tempo rausnehmen und Sicherheit schaffen: „Bitte erklären Sie mir, welche Rechte ich hier habe – und was wirklich Frist oder Pflicht ist.“ Und: „Ich hätte die rechtliche Grundlage gerne schriftlich.“ So behaltet ihr den Überblick – Schritt für Schritt, in eurem Tempo.
Die Regelungen bei Fehl- und Totgeburt – die juristische Grenze
Rechtlich wird in Deutschland vor allem nach Gewicht unterschieden. Wird ein Kind ohne Lebenszeichen geboren und wog es unter 500 Gramm, spricht man von einer Fehlgeburt; ab 500 Gramm von einer Totgeburt. Diese Schwelle steuert Folgefragen wie Standesamtseintrag, Mutterschutz und Bestattungspflichten. Sie ist eine Verwaltungs-Grenze, kein Maß für Liebe oder Bedeutung. Wichtig ist auch die zweite Grundregel: Gab es bei der Geburt irgendwelche Lebenszeichen – Atem, Herzschlag, Nabelschnurpuls, willkürliche Bewegung – gilt es immer als Lebendgeburt, ganz unabhängig vom Gewicht; dann erfolgt eine reguläre Beurkundung mit anschließender Sterbeurkunde.
Wenn das Gewicht unklar ist – so wird eingeordnet
In der Praxis kann das Gewicht nicht immer eindeutig feststellbar sein. Dann orientieren sich Kliniken ergänzend am Schwangerschaftsalter und an der ärztlichen Dokumentation; entscheidend ist am Ende, was im Bescheinigungssatz für das Standesamt steht. Für euch heißt das: Die Begriffe ordnen vor allem Formales. Medizinisch bekommt ihr in beiden Situationen sorgfältige Versorgung, und menschlich bleibt es derselbe Abschied. Wenn etwas unklar ist, bittet um einen klaren Satz in Alltagssprache – „Was bedeutet unsere Einordnung konkret für Standesamt, Mutterschutz und Bestattung hier vor Ort?“ – und lasst euch die Grundlage schriftlich geben.
Namen, Urkunden, Standesamt – Sichtbarkeit ist erlaubt
Auch bei sehr frühen Verlusten dürft ihr euer Sternenkind sichtbar machen. Seit 2013 kann das Standesamt auf Antrag eine „Bescheinigung über eine Fehlgeburt“ ausstellen. Darin können – wenn ihr möchtet – Vorname(n), Geschlecht (soweit feststellbar), Ort und Zeit der Geburt sowie die Eltern stehen. Das Dokument ist keine Geburts- oder Sterbeurkunde, aber eine offizielle Urkunde, die Zugehörigkeit würdigt und die ihr zu euren Unterlagen legen könnt. Für die Beantragung genügt in der Regel die kurze ärztliche Bestätigung aus Klinik oder Praxis; eine feste Frist gibt es nicht, sinnvoll ist „bald“, solange alles greifbar ist. Gebühren fallen – wenn überhaupt – nur in kleinem Rahmen an. Wenn das Geschlecht nicht sicher bestimmbar ist, kann das Standesamt „unbestimmt“ eintragen; beim Vornamen seid ihr frei, auch ein geschlechtsneutraler Name ist möglich.
Standesamt bei Totgeburt: Registerauszug statt Sterbeurkunde
Bei einer Totgeburt (ohne Lebenszeichen ab 500 g) nimmt das Standesamt einen regulären Eintrag im Geburtenregister vor, vermerkt die Totgeburt und stellt euch entsprechende Auszüge aus. Die Anzeige läuft meist durch die Klinik; ihr werdet informiert, wann die Unterlagen abholbereit sind. Eine gesonderte Sterbeurkunde gibt es hier nicht, weil es keine Lebenszeichen gab – der Registerauszug trägt den Sachverhalt.
Wenn ihr nicht verheiratet seid, stellt sich oft die Elternbenennung. Grundsätzlich können – wie bei jeder Geburt – beide Elternteile in den standesamtlichen Unterlagen erscheinen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Klärt mit eurem Standesamt, welche Nachweise es in eurem Fall braucht (zum Beispiel bereits abgegebene Anerkennungserklärungen, Identitätsnachweise, ggf. Sorgeerklärungen). Ziel ist, dass eure familiäre Realität in der Urkunde sichtbar wird – auch dann, wenn euer Kind nicht lebend geboren wurde.
Sternenkind offiziell machen: Was die Fehlgeburts-Bescheinigung kann
Praktisch heißt das: Nach einer Fehlgeburt unter 500 g könnt ihr die Bescheinigung aktiv beantragen und den Namen eures Kindes eintragen lassen; der Nachname richtet sich nach euren allgemeinen Namensregeln. Nach einer Totgeburt ab 500 g wird die Beurkundung von der Klinik angestoßen; ihr holt die Registerauszüge ab und könnt dort ebenfalls den gewählten Vornamen festhalten. Wenn unterwegs etwas unklar bleibt, sagt den Satz, der Ordnung schafft: „Bitte in einfachen Worten – was ist hier möglich, was braucht es an Nachweisen, und welche Unterlagen bekomme ich am Ende in die Hand?“ So wird Sichtbarkeit nicht zur Hürde, sondern zu einem Schritt, der eure Liebe würdigt.
Bestattung – Pflicht, Möglichkeit und würdige Wege
Totgeburt: Bestattung ist Pflicht – Formen, Fristen, Ablauf
Bei einer Totgeburt ist die Bestattung in allen Bundesländern verpflichtend. Was genau erlaubt ist – Erdbestattung oder Feuerbestattung, welche Grabformen, welche Fristen – regeln die Bestattungsgesetze der Länder. Deine Klinik stellt die nötigen Dokumente bereit, ein Bestattungsunternehmen organisiert die Überführung und bespricht mit euch die nächsten Schritte. Es gibt keine „richtige“ Art der Bestattung, nur eine, die zu euch passt und die ihr in eurem Tempo tragen könnt.
Nach Fehlgeburt: Von Sammel- bis Einzelgrab – eure Optionen
Nach einer Fehlgeburt besteht in den meisten Ländern keine Bestattungspflicht, wohl aber die Möglichkeit. Ihr dürft euer Sternenkind bestatten – müsst aber nicht. Viele Städte und Kliniken bieten regelmäßige, würdevolle Sammelbestattungen an; manche Friedhöfe haben eigene Sternenkinderfelder oder Gemeinschaftsgräber. Anderswo gibt es Reihengräber, Wahlgräber, anonyme oder halbanonyme Beisetzungen. Weil die Angebote und Gebühren regional sehr unterschiedlich sind, lohnt ein kurzer Anruf beim Standesamt oder Friedhofsamt: „Welche Formen gibt es bei uns? Welche Unterlagen brauchen Sie? Welche Kosten fallen an – und gibt es Ermäßigungen für Sternenkinder?“ So kommt ihr schnell zu verlässlichen Optionen.
Kosten & Ablauf der Bestattung – fair geregelt, Schritt für Schritt
Bei Totgeburten gelten grundsätzlich die üblichen Bestattungsregeln. Das bedeutet: Gebühren des Friedhofs (Grabnutzung, Beisetzungs- und ggf. Pflegekosten), Leistungen des Bestatters (Überführung, Sarg/Urne, Trauerfeier), dazu – wenn gewünscht – Blumenschmuck oder Redner:in. Viele Kommunen reduzieren Gebühren für Sternenkinder, manche Kliniken tragen die Kosten für Sammelbestattungen ganz oder teilweise. Fragt konkret danach. Wenn euch die Kosten überfordern, kann das Sozialamt in Härtefällen mit „Hilfe zur Bestattung“ unterstützen. Das ist keine Bittstellung, sondern eine gesetzlich vorgesehene Absicherung – sprecht das offen an.
Praktisch hilft eine kleine Reihenfolge: Die Klinik stellt ärztliche Bescheinigungen aus und erklärt, welche Unterlagen das Bestattungsunternehmen braucht. Der Bestatter klärt mit euch Form, Ort und Zeitpunkt der Beisetzung, beantragt beim Friedhof die Termine und koordiniert die Überführung. Ihr entscheidet, was zu euch passt: eine stille Beisetzung nur im engsten Kreis, eine kleine Zeremonie mit Worten, Musik, religiösen oder weltanschaulichen Elementen – oder (bei Fehlgeburt) die Teilnahme an einer Sammelbestattung, wenn die eigenen Kräfte begrenzt sind. Alles darf schlicht sein. Würde hängt nicht an Größe, sondern an Passung.
Wenn euer Herz an einem bestimmten Ort hängt, sagt es. Manche Eltern wünschen sich eine Urnenbeisetzung in räumlicher Nähe, andere einen Gemeinschaftsort, der ohne Pflegeaufwand trägt. Manche möchten später umbetten – das ist je nach Landesrecht und Friedhofsordnung möglich, braucht aber formale Schritte. Sprecht Wünsche offen an, bevor ihr euch festlegt; gute Bestatter:innen erklären euch die Spielräume.
Und für die Fragen, die unterwegs oft auftauchen, zwei Sätze, die Ordnung schaffen: „Bitte sagen Sie mir, was heute entschieden werden muss – und was noch warten kann.“ Und: „Bitte nennen Sie mir die örtlichen Regeln und die nächsten, kleinsten Schritte.“ So bleibt der Abschied eures Sternenkindes ein würdiger Weg in eurem Tempo – mit Raum für Nähe, für Stille und für die Form, die euch trägt.
Mutterschutz, Krankschreibung, Leistungen – was dir zusteht
Nach einer Totgeburt gilt für dich der Mutterschutz nach der Entbindung – wie nach jeder Geburt. Das bedeutet: eine gesetzliche Schutzfrist ohne Beschäftigung, finanziert durch Mutterschaftsgeld (wenn die Voraussetzungen erfüllt sind) und den Arbeitgeberzuschuss. Deine Klinik stellt die nötigen Bescheinigungen aus, die Krankenkasse erklärt dir die nächsten Schritte. Du musst keine Zahlen im Kopf haben; wichtig ist nur: Es gibt einen klaren, gesetzlich gesicherten Rahmen für Erholung, Heilung und Rückkehr in den Alltag.
Eine Lücke schließt der Gesetzgeber zum 1. Juni 2025: Auch nach Fehlgeburten ab der 13. Schwangerschaftswoche gelten dann eigene Mutterschutzfristen – gestaffelt nach Schwangerschaftswoche (zum Beispiel zwei Wochen ab der 13., vier Wochen ab der 17., acht Wochen ab der 20. SSW). Damit bekommst du auch ohne lebend geborenes Kind einen verbindlichen Schutzanspruch. Praktisch heißt das: Heb dir die ärztlichen Nachweise gut auf, melde dich früh bei Arbeitgeber und Krankenkasse und sag ruhig den Satz: „Wir hatten eine Fehlgeburt in Woche … – welche Unterlagen brauchen Sie für meinen Mutterschutz?“
Unabhängig von Schutzfristen kann dich deine Ärztin/dein Arzt krankschreiben. Das ist eine medizinische Entscheidung und kein „Antrag“, den du erst rechtfertigen müsstest. Wenn Schlaf, Kreislauf, Schmerzen oder seelische Belastung es erfordern, ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schlicht Teil guter Versorgung. Für die Kommunikation mit dem Arbeitgeber reichen in der Regel kurze, sachliche Informationen: „Ich bin ärztlich krankgeschrieben. Die voraussichtliche Dauer teile ich mit, sobald sie feststeht.“
Elternzeit, Elterngeld & Kindergeld – was rechtlich gilt und welche Spielräume ihr im Job habt!
Elternzeit, Elterngeld und Kindergeld setzen rechtlich ein lebendes Kind voraus, das bei euch lebt. Nach einer Totgeburt bestehen daher keine Ansprüche. Viele Personalstellen zeigen sich in dieser Situation trotzdem entgegenkommend (Sonderurlaub, flexible Rückkehr, Homeoffice-Übergänge). Es hilft, konkret zu fragen: „Welche Möglichkeiten der bezahlten oder unbezahlten Freistellung gibt es bei uns in Trauerfällen?“ Wenn es Betriebs- oder Tarifregeln gibt, nennt man dir sie; wenn nicht, lassen sich oft individuelle Lösungen finden.
Für Partner:innen gibt es keinen Mutterschutz im gesetzlichen Sinn. Je nach Betrieb und Tarifvertrag sind aber Sonderurlaub oder kurzfristige Freistellung möglich – manchmal auch unter Verweis auf „wichtigen persönlichen Grund“. Frag direkt und klar nach einer Lösung, die euch die ersten Tage schützt: „Wir hatten eine Tot-/Fehlgeburt – können Sie mir X Tage freigeben (bezahlt/unbezahlt)? Welche Nachweise brauchen Sie?“ Viele Arbeitgeber reagieren fair, wenn sie wissen, was passiert ist, und hören, was du brauchst.
Wenn du unsicher bist, was als Nächstes zu tun ist, genügen zwei Sätze: „Bitte sagen Sie mir, was heute entschieden werden muss – und was noch warten kann.“ Und: „Können Sie mir kurz schriftlich zusammenfassen, welche Unterlagen Sie brauchen?“ So bleibt die Organisation so leicht wie möglich, und du hast den Rücken frei für das, was gerade zählt: heilen, atmen, trauern – in deinem Tempo.
Medizinische Entscheidungen, Einsicht, Fetopathologie – eure Rechte
Ihr habt Anspruch darauf, dass euch Befunde und Optionen so erklärt werden, dass ihr sie wirklich versteht. Das heißt: klare Alltagssprache, keine Abkürzungen, keine Eile. Ihr dürft Fragen stellen, eine kurze schriftliche Zusammenfassung verlangen und um einen ruhigen Zweittermin bitten. Wenn ihr das möchtet, kann eine vertraute Person dabeisitzen; bei Sprachbarrieren habt ihr Anspruch auf verständliche Vermittlung. Eine Zweitmeinung ist jederzeit legitim – dafür bekommt ihr Kopien der relevanten Unterlagen.
Nach deutschem Patientenrecht könnt ihr eure Krankenunterlagen einsehen und Kopien erhalten – elektronisch oder auf Papier. Dazu zählen Arztbriefe, Ultraschall- und Laborbefunde, OP-/Geburtsberichte, Medikation, Aufklärungs- und Einwilligungsbögen. Sagt gern konkret: „Bitte um vollständige Kopie aller Befunde dieses Aufenthalts, inklusive Ultraschallbildern.“ Die Klinik darf für Kopien einen angemessenen Aufwand berechnen; medizinisch Wesentliches solltet ihr ohne Hürden bekommen. Wichtig: Rechtsträger der Akte ist die Patientin – der Partner erhält Unterlagen nur mit eurer ausdrücklichen Zustimmung. Ihr könnt auch festlegen, wer (Hausärztin, Hebamme, Beratungsstelle) zusätzlich eine Kopie bekommt.
Fetopathologie (Obduktion) – Einwilligung, Optionen, Ergebnisse & Unterlagen
Zur fetopathologischen Untersuchung (Obduktion): Sie findet nur mit eurer Einwilligung statt – außer es bestünde eine gesetzliche Pflicht (selten, z. B. rechtsmedizinische Klärung). Ihr bestimmt den Umfang: nur äußere Inspektion, nur Plazentahistologie, ausgewählte Organe, klassische Obduktion, minimal-invasiv oder Bildgebung (z. B. MRT) – und ihr könnt zusätzliche genetische Analysen gesondert erlauben oder ausschließen. Ebenso legt ihr fest, ob und wie lange Gewebeproben aufbewahrt werden dürfen, ob Material vernichtet oder – wo möglich – an euch bzw. an das Bestattungsinstitut zurückgegeben werden soll. Diese Punkte gehören in das Aufklärungs-/Einwilligungsformular; ihr dürft jeden Punkt in Ruhe durchgehen und habt das Recht, eine bereits erteilte Einwilligung bis zur Durchführung zu widerrufen.
Eine Fetopathologie kann klären, was passiert ist, und ob sich daraus Hinweise für das Wiederholungsrisiko in künftigen Schwangerschaften ergeben. Sie kann entlasten, wenn Schuldfragen kreisen, und sie strukturiert die Ergebnisbesprechung mit eurer Ärztin. Ergebnisse brauchen Zeit – oft einige Wochen. Vereinbart gleich jetzt einen Termin „in Ruhe“ zur Rückmeldung, wenn ihr wieder etwas mehr Boden habt, und bittet um einen schriftlichen Befund in verständlicher Sprache. Ihr entscheidet, wer die Ergebnisse außer euch sehen soll.
Ihr könnt Ultraschallbilder, den Geburtsbericht und – falls erstellt – klinische Fotos erhalten. Fragt ruhig aktiv danach; es hilft später beim Einordnen. Formuliert klar: „Bitte alles in Alltagssprache zusammenfassen und mir schriftlich mitgeben.“ Und wenn euch im Moment noch jede Zeile zu viel ist, lasst euch die Unterlagen dennoch aushändigen – nachlesen dürft ihr, wenn es für euch passt.
Sehen, Halten, Fotografieren – erlaubt und würdig
Ihr dürft euer Sternenkind sehen, halten, fotografieren; ihr dürft Hand- und Fußabdrücke machen lassen und kleine Erinnerungsstücke mitnehmen – ein Mützchen, das Bändchen, eine Locke, den Namenszettel. Das ist kein Muss. Es ist ein Angebot, Nähe in eurem Tempo und in einer Form zu erleben, die ihr halten könnt. Sagt dem Team, was ihr braucht: gedämpftes Licht, Zeit, eine Decke, Kleidung in passender Größe, jemanden, der behutsam wäscht, anzieht und euch euer Sternenkind anreicht. Wenn ihr Sorge habt, wie euer Sternenkind aussieht, bittet zuerst um eine Beschreibung oder um einen kurzen Blick der Hebamme; ihr dürft die Nähe dosieren und jederzeit eine Pause machen.
Manche Kliniken haben Kühlwiegen („Cuddle Cots“) oder einen ruhigen Abschiedsraum. Je nach Klinikablauf und Landesrecht könnt ihr euer Sternenkind für begrenzte Zeit bei euch behalten – im Zimmer oder, nach Absprache, kurz zu Hause. Fragt nach dem konkreten Rahmen und nach einer Ansprechperson, die euch begleitet. Wenn Geschwister, Großeltern oder eine vertraute Person kommen sollen, sagt es offen – ihr bestimmt, wer dabei ist und wann.
Fotografie & Ablauf – privat, würdevoll, in eurem Tempo
Fotos sind erlaubt – mit eurem Handy oder mit Hilfe der Klinik. Es reicht, wenn es einfache, wahre Bilder sind. Die Hand in eurer, ein Detail der Füße, das Gesicht, die Decke, der Name auf der Karte. Wenn ihr noch unsicher seid, bittet das Team, Bilder und Abdrücke für euch anzufertigen und versiegelt aufzubewahren; ihr entscheidet später, ob und wann ihr sie sehen möchtet. Auch professionelle Sternenkind-Fotografie gibt es mancherorts über ehrenamtliche Netzwerke; die Klinik kann sagen, was kurzfristig möglich ist. Wichtig: Die Bilder sind nur für euch. Ihr müsst nichts teilen, niemandem etwas zeigen, nichts sofort entscheiden.
Wenn eine fetopathologische Untersuchung geplant ist, klärt kurz die Reihenfolge. Erst Abschied und Erinnerungsstücke, dann Untersuchung – oder umgekehrt, wenn das medizinisch nötig ist. Sprecht aus, was euch wichtig ist: der Name, ein Segen, ein kurzer Satz, ein Stück Musik, ein Foto allein und eines mit euch. Nähe heißt hier: in eurem Maß. Ein ruhiger Einstieg, ein klarer Ausstieg, danach etwas Wärmendes oder Nährendes. Alles, was ihr heute nicht könnt, darf offenbleiben. Verbundenheit hat viele Wege – und ihr dürft den wählen, der euch schützt und euer Sternenkind würdigt.
Wer entscheidet – und in welcher Reihenfolge?
Bei allen medizinischen Fragen geht es rechtlich zuerst um den Körper der Mutter. Sie ist Patientin, also trifft sie die Entscheidungen: Aufklärung, Einwilligung, Schmerztherapie, Einleitung, Narkose, Einsicht in Unterlagen. Der Partner oder die Partnerin kann und soll einbezogen werden, aber die wirksame Einwilligung kommt von ihr. Ist sie vorübergehend nicht entscheidungsfähig, handelt das Team nach dem mutmaßlichen Willen und zum Schutz der Patientin; sobald erreichbar, werden Entscheidungen nachgeholt oder bestätigt. Sprecht es ruhig aus: „Ich entscheide – und wir möchten gemeinsam sprechen.“ Lasst euch in der Akte eine Hauptansprechperson mit Telefonnummer hinterlegen, damit das Team euch gezielt erreicht.
Bei Untersuchungen am Kind/Placenta (fetopathologische Untersuchung) wird in der Praxis ebenfalls die Einwilligung der Mutter eingeholt, weil das Material aus ihrem Körper stammt und sie Patientin ist. Viele Kliniken beziehen, wenn möglich, beide Eltern in die Aufklärung ein. Ihr dürft Umfang, Grenzen und den Umgang mit Proben festlegen. Wenn ihr euch uneinig seid, bremst das Team sinnvollerweise, bis Klarheit besteht – außer es gibt drängende medizinische Gründe.
Standesamt & Bestattung – wer entscheidet und was gilt bei Uneinigkeit
Für Standesamt und Bestattung seid ihr als Eltern grundsätzlich zuständig. Wenn ihr verheiratet seid oder Vaterschaft/Mit-Mutterschaft anerkannt ist, werdet ihr als Eltern gemeinsam angesprochen. Seid ihr nicht verheiratet und liegt (noch) keine Anerkennung vor, entscheidet formal zunächst die Mutter; das Standesamt kann Vaterschaftsanerkennung und, falls gewünscht, gemeinsame Sorge erklären – auch rund um die Geburt. Sprecht mit dem Standesamt, welche Nachweise gebraucht werden, damit ihr beide sichtbar werdet.
Kommt es bei der Bestattung zu Uneinigkeit, greifen die landesrechtlichen Reihenfolgen der Bestattungspflichtigen. Meist steht der Ehe-/Lebenspartner an erster Stelle, dann die Eltern des Kindes, danach weitere Angehörige. In der Praxis moderieren Friedhofsamt oder Standesamt; wenn es gar nicht anders geht, kann die Ordnungsbehörde eine Entscheidung treffen. Euer Ziel bleibt Würde und Machbarkeit, nicht „Recht behalten“. Fragt unaufgeregt nach Vermittlung oder, in der Klinik, nach einer Ethik- oder Sozialdienst-Unterstützung.
Besondere Konstellationen: Mehrlinge, Minderjährige & getrennte Eltern – Entscheidungswege
Bei Mehrlingen wird jedes Kind rechtlich einzeln betrachtet, ihr dürft aber selbstverständlich gemeinsame Entscheidungen (z. B. Bestattungsform) treffen. Bei minderjährigen Müttern kommt es auf die Einwilligungsfähigkeit an. Viele Jugendliche können medizinisch selbst einwilligen; wenn nicht, entscheiden die Sorgeberechtigten mit. Getrennte Paare mit gemeinsamer Sorge bleiben entscheidungsbefugt; hilfreich ist, eine sprechfähige Person als „erste Kontaktperson“ zu benennen und das im Kliniksystem zu hinterlegen.
Wenn gerade nur ein Elternteil anwesend ist, trifft er oder sie die nötigen Entscheidungen – idealerweise mit kurzer Rücksprache per Telefon. Wichtig ist, dass das Team weiß, wen es wann erreichen kann, was euch wichtig ist und wo es (noch) Gesprächsbedarf gibt. Ein einfacher Satz schützt: „Bitte halten Sie medizinische Eilentscheidungen mit mir ab, alles Andere besprechen wir gemeinsam, sobald wir zusammen sind.“ So bleibt Handlungsfähigkeit gewahrt – und ihr behaltet die Richtung.
Fristen & Formales – damit ihr nichts verpasst
Beim Standesamt läuft nach einer Totgeburt die Anzeige in der Regel automatisch über die Klinik; ihr werdet informiert, wann und wo ihr die Unterlagen abholen könnt. Fragt dort nach, welche Dokumente sie benötigen (Personalausweise, ggf. Heiratsurkunde, Klinikbescheinigung) und ob eine Abholung durch eine bevollmächtigte Person möglich ist. Bei einer Fehlgeburt gibt es keine starre Frist für die „Bescheinigung über eine Fehlgeburt“. Praktisch ist es, sie zeitnah zu beantragen, solange die ärztliche Bestätigung schnell greifbar ist. Haltet Namen und Kontaktdaten einer Ansprechperson im Standesamt fest und macht euch Kopien bzw. Fotos aller Unterlagen für eure Mappe.
Für die Bestattung gelten landesrechtliche Vorgaben zu Fristen und Formen. Das klingt abstrakt, ist aber mit einem kurzen Anruf gut zu klären. Friedhofsamt oder Bestatter sagen euch, bis wann was entschieden sein sollte und welche Optionen es vor Ort gibt (Einzel- oder Sammelbestattung, Sternenkinderfelder, Trauerraum). Sagt offen, was ihr braucht: „Wir möchten würdig Abschied nehmen und keinen Zeitdruck. Welche Fristen gelten hier konkret?“ So vermeidet ihr Hektik und Missverständnisse, und ihr bekommt realistische Zeitfenster.
Leistungen & Nachweise – Mutterschutz, AU und Fristen (ab 1.6.2025)
Leistungen wie Mutterschutz, Mutterschaftsgeld und eine mögliche Krankschreibung solltet ihr früh mit Arbeitgeber und Krankenkasse klären. Reicht ärztliche Bescheinigungen und – wenn vorhanden – standesamtliche Unterlagen direkt ein und notiert euch, was bereits angekommen ist. Für die neuen Schutzfristen nach Fehlgeburten ab der 13. SSW gilt: Sie treten am 1. Juni 2025 in Kraft. Wenn euer Ereignis davor lag, gelten die bis dahin bestehenden Regeln; liegt es danach, verweist bei Rückfragen ruhig auf den neuen Starttermin. Wichtig ist nicht, jedes Detail auswendig zu wissen, sondern eine verlässliche Ansprechperson zu haben und die eigenen Unterlagen geordnet zu halten.
Datenschutz, Diskretion, Fotos – wer darf was?
Eure Krankengeschichte steht unter Schweigepflicht. Ohne eure ausdrückliche Zustimmung gibt das Team keine Informationen an Dritte weiter – nicht an Angehörige, Bekannte oder Arbeitgeber. Sagt gern klar: „Bitte nur mit mir/meinem Partner sprechen.“ Ihr könnt diese Freigabe jederzeit ändern oder widerrufen. Einsicht in Unterlagen bekommt ihr selbst; andere nur mit eurer Vollmacht.
In eurem Zimmer gilt das Hausrecht der Klinik. Eigene Fotos sind erlaubt, solange ihr niemanden Fremden mit ablichtet. Wenn ihr eine Sternenkind-Fotografin hinzuholen möchtet, stimmt das kurz mit Station/Rooming ab – meistens ist das problemlos. Fremde dürfen keine Fotos von euch/eurem Kind machen. Das „Recht am eigenen Bild“ schützt euch. Bilder dürfen nur mit eurer Einwilligung entstehen und verwendet werden; die Einwilligung könnt ihr auch später widerrufen.
Für Social Media gilt: Zeigt nur, was ihr wirklich teilen wollt. Vermeidet erkennbare Gesichter Dritter, achtet auf Details im Hintergrund (Namensschilder, Armbänder) und löscht bei Bedarf die Orts-/Zeit-Metadaten eurer Dateien. Wenn ihr Diskretion möchtet, bittet das Team um ein entsprechendes Türschild („Bitte nicht stören“/„Sensibles Gespräch“). Kurz gesagt: Ihr entscheidet, wer was erfährt, wer den Raum betritt – und welche Bilder bleiben, privat oder öffentlich.
Besonderheiten: Mehrlinge, sehr frühe Verluste, andere Konstellationen
Bei Mehrlingen wird jedes Kind einzeln betrachtet – medizinisch, rechtlich und in der Bestattung. Das heißt: Es kann für jedes Kind unterschiedliche Unterlagen und Entscheidungen geben. Wenn ein Kind lebend geboren wird und ein Geschwisterchen ohne Lebenszeichen, werden sowohl eine Lebendgeburt (mit späterer Sterbeurkunde) als auch eine Tot-/Fehlgeburt beurkundet. Auch bei unterschiedlichen Gewichten gilt die Grenze von 500 g pro Kind separat. Für die Bestattung dürft ihr entscheiden, ob die Kinder gemeinsam oder getrennt beigesetzt werden; beides ist würdig. Kliniken und Bestatter kennen die besonderen Abläufe bei Mehrlingen und helfen, Namen, Erinnerungsstücke und Abschiedsformen so zu gestalten, dass jedes Kind sichtbar bleibt – und zugleich euer Abschied zusammenhängend erlebbar ist.
Sehr frühe Verluste – rechtlich leiser, nicht weniger real!
Sehr frühe Verluste – etwa eine biochemische Schwangerschaft oder eine anembryonale Schwangerschaft („Windei“) – sind rechtlich oft leiser, aber nicht weniger real. Ihr dürft diese Schwangerschaft benennen, ihr dürft um euer Sternenkind trauern und – je nach regionaler Praxis – auch eine Bestattung wählen, zum Beispiel im Rahmen von Sammelbestattungen. Fragt in der Klinik, ob und wie solche Angebote vor Ort organisiert sind. Eine personenstandsrechtliche Bescheinigung („Sternenkind“-Bescheinigung nach § 31 PStV) ist in vielen Fällen möglich, wenn eine ärztliche Bestätigung des Schwangerschaftsverlustes vorliegt. Das Standesamt erklärt euch, welche Nachweise es genau braucht.
Regenbogen- und Patchworkfamilien – rechtliche Elternschaft sichtbar machen
In Regenbogen- und Patchworkfamilien ist entscheidend, wer rechtlich Eltern ist – unabhängig davon, wie ihr euch im Herzen verbunden fühlt. Je nach Konstellation kommen Vaterschaftsanerkennung, Sorgerechtserklärung, Ehe- oder Lebenspartnerschaft, gegebenenfalls eine Mit-Eltern-Regelung und Bescheinigungen des Jugendamts/Standesamts in Betracht. Klärt diese Punkte möglichst früh mit Standesamt und Jugendamt; beide Stellen sagen euch, welche Erklärungen schon vor der Geburt möglich sind, damit in den Unterlagen beide Eltern sichtbar werden. Auch wenn die rechtlichen Wege je nach Bundesland und aktueller Gesetzeslage etwas unterschiedlich sind. Eure Familie darf als Familie vorkommen – in der Sprache, in den Dokumenten und im Abschied.
Psychotherapie, Beratung, Seelsorge – was wird übernommen?
Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf psychotherapeutische Versorgung. Der erste Schritt ist oft die psychotherapeutische Sprechstunde. Ein kurzer, zeitnaher Termin zur Einordnung und Empfehlung der nächsten Schritte. Daraus kann – wenn es passt – eine Akutbehandlung entstehen, um dich kurzfristig zu stabilisieren, oder eine reguläre Richtlinienpsychotherapie (tiefenpsychologisch, analytisch oder verhaltenstherapeutisch). Die Kosten übernimmt die Krankenkasse; du brauchst in der Regel keine Überweisung, deine Gesundheitskarte reicht. Wartezeiten sind möglich, aber in Krisen gibt es Akutplätze und ambulante Anlaufstellen, die kurzfristig überbrücken.
Viele Kliniken und Perinatalzentren kooperieren mit psychosozialen Diensten, Trauerbegleitung und Seelsorge; diese Angebote sind für euch kostenfrei und können parallel zur Therapie laufen. Auch Hebammen, Sozialdienste und Selbsthilfegruppen sind wichtige Anker – niedrigschwellig, ohne Papierkrieg. Sag früh, was du brauchst: „Heute nur Stabilisierung und klare Sätze“ oder „Wir wünschen einen Termin in zwei Wochen, wenn es etwas ruhiger ist.“ Das hilft, Tempo und Dosis zu schützen.
Wenn ihr lieber privat ergänzt (Trauercoaching, Paarberatung), prüft vorab Kosten und Qualifikation; manche Kassen erstatten in Einzelfällen nach Antrag. In akuter Not gilt: sofort sprechen – mit einer vertrauten Person, der nächstgelegenen psychiatrischen Ambulanz oder dem Rettungsdienst (112). Ziel bleibt immer dasselbe: Sicherheit, ein verlässlicher Rahmen und dann Schritt für Schritt zurück in einen Rhythmus, der trägt.
Arbeit, Schule, Umfeld – Worte, die schützen
Du musst niemandem etwas beweisen oder alles erklären. Für den Arbeitgeber reichen in der Regel die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder – nach Totgeburt – der Hinweis auf Mutterschutz. Wenn du Worte brauchst, halte sie kurz und wahr: „Unser Kind ist tot zur Welt gekommen. Ich brauche Zeit. Ich melde mich, sobald ich wieder starten kann.“ Das ist ausreichend. Wenn es dir hilft, benenn eine Ansprechperson: „Bitte stimmen Sie Organisatorisches vorerst mit meiner Frau/meinem Mann ab.“ Viele Personalstellen bieten ein Rückkehrgespräch an; du darfst Wünsche formulieren: eine schrittweise Rückkehr, vorerst weniger Kundentermine, kein Wartezimmerdienst, kein Babykontakt. Schreib’s ruhig in einen Zweizeiler, damit niemand „gut gemeint“ über dich entscheidet.
Im Team schützt eine Minimalformel: „Wir hatten eine stille Geburt. Ich arbeite wieder, bin aber dünnhäutig. Bitte keine Details – danke fürs Mitdenken.“ Eine Vertrauensperson im Kollegenkreis kann abfangen und Gespräche beenden, wenn du es nicht möchtest. Social Media ist optional: Wenn öffentlich, dann nach einer Nacht Schlaf und mit einer klaren Grenze („Wir teilen das, bitten aber um Raum“). Schweigen ist genauso würdig.
Schule, Kita & nahes Umfeld – klare Worte, hilfreiche Grenzen
Für Schule und Kita von Geschwisterkindern genügen einfache, direkte Sätze: „Wir hatten eine still geborene Schwester/einen still geborenen Bruder. Unser Kind ist heute dünnhäutig – bitte mitdenken.“ Bitte um kurze Rückmeldungen, wenn es Auffälligkeiten gab, und um kleine Anpassungen, die entlasten: flexible Abholzeit, kein Überraschungsprojekt „Babys“, eine vorab besprochene Ausweichmöglichkeit, wenn es zu viel wird. Lehrkräfte und Erzieher:innen sind dankbar für klare Hinweise; du musst keine langen Mails schreiben.
Im Freundes- und Familienkreis trägt „Präsenz vor Problemlösung“. Du darfst sagen: „Wir möchten keine Ratschläge, nur Dasein.“ Oder: „Fragt bitte nicht nach Gründen. Ein ‚Es tut mir leid‘ reicht.“ Wer dir nahe steht, kann konkret helfen: Einkäufe, Fahrten, Post. Setz Grenzen, ohne Schuld: „Heute nicht sprechen. Morgen gern zehn Minuten.“ Sprache ist hier Schutzfolie – kurz, wahr, wiederholbar. So bleibt deine Geschichte in deiner Hand und der Tag etwas leichter.
Was bleibt wichtig
Ihr habt mehr Rechte, als viele denken. Auf einen Namen für euer Sternenkind, auf offizielle Dokumente, auf eine würdige Bestattung – verpflichtend nur bei Totgeburt –, auf Mutterschutz nach Totgeburt und ab 1. Juni 2025 auch nach später Fehlgeburt, sowie auf ruhige, verständliche Aufklärung und Einsicht in eure Unterlagen. Vieles ist eine Möglichkeit, keine Pflicht. Weil Bestattung, Fristen und einzelne Abläufe Landesrecht sind, lohnt der kurze Anruf beim Standesamt oder Friedhofsamt eurer Kommune. Dort sagen sie euch, was vor Ort gilt, welche Fristen wirklich laufen und welche Unterstützungen es gibt.
Wenn etwas unklar bleibt, nehmt zwei Sätze mit, die Türen öffnen und Tempo rausnehmen: „Bitte erklären Sie mir, welche Rechte ich hier habe – und was wirklich Frist oder Pflicht ist.“ Und: „Ich hätte die rechtliche Grundlage gerne schriftlich.“ Das verlangsamt, schützt und gibt euch Handlungssicherheit – Schritt für Schritt. Fragt außerdem nach einer kurzen schriftlichen Zusammenfassung in Alltagssprache und nach einem ruhigen Zweittermin, wenn ihr wieder mehr Boden habt. Ihr müsst nichts sofort entscheiden, solange keine akute medizinische Gefahr besteht.
Wichtig ist auch, dass ihr Sichtbarkeit selbst bestimmt. Jede Schwangerschaft zählt. Jedes Kind darf einen Namen haben – auch ohne Registerpflicht. Erinnerungsstücke sind erlaubt, wenn es für euch stimmig ist; Alternativen mit Rückweg sind genauso würdig. Und ihr dürft trauern, so wie es zu euch passt: leise, sichtbar, gemeinsam oder versetzt – ohne Rechtfertigung gegenüber Außenstehenden. Rechte sind dazu da, euch zu schützen, nicht euch zu drängen. Euer Maßstab bleibt euer Körper und eure Werte.
Weiterführende Links & Ressourcen
FAQ – Rechtliches rund um Sternenkinder
Kurze, klare Antworten. Lies nur das, was heute hilft.
Fehlgeburt oder Totgeburt – was ist der Unterschied?
Zählt jedes Lebenszeichen als Lebendgeburt?
Gewicht unklar – wie wird eingeordnet?
Können wir unserem Sternenkind einen Namen geben?
Was leistet die „Bescheinigung über eine Fehlgeburt“?
Standesamt bei Totgeburt – welche Unterlagen bekommen wir?
Nicht verheiratet – wie werden beide Eltern genannt?
Ist eine Bestattung Pflicht?
Welche Bestattungsoptionen gibt es nach Fehlgeburt?
Mit welchen Kosten ist zu rechnen – gibt es Unterstützung?
Wie läuft die Organisation der Bestattung ab?
Gilt Mutterschutz nach Totgeburt?
Neuregelung ab 1.6.2025 bei Fehlgeburt?
Krankschreibung – geht das zusätzlich?
Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld – gibt es Ansprüche?
Patientenrechte: Aufklärung, Akteneinsicht, Zweitmeinung
Fetopathologie (Obduktion) – Einwilligung und Ablauf
Dürfen wir sehen, halten, fotografieren – und Erinnerungen mitnehmen?
Wer entscheidet medizinisch – und wer bei Standesamt/Bestattung?
Fristen & Formales – was sollten wir beachten?
Datenschutz & Bildrechte – wer darf was?
Mehrlinge & sehr frühe Verluste – was gilt?
Regenbogen- oder Patchworkfamilien – wie werden Eltern sichtbar?
Psychotherapie, Beratung, Seelsorge – was wird übernommen?
Arbeit, Schule, Umfeld – Formulierungen, die schützen
Hinweis: Diese FAQs ersetzen keine Rechtsberatung. Regionale Unterschiede bitte beim örtlichen Standes- oder Friedhofsamt klären.